Kapitel 11
Es gab wenig zu reden mit der Raumpflegerin, die an Deborahs Stelle trat, zumal sie bestenfalls einige Brocken meiner Sprache beherrschte: „Wie geht? Jetzt putzen ... Gehen einkaufen.“ Ich sah nur die Raumpflegerin, nicht aber, dass es diese Frau, so sehe ich es heute, nicht viel anders als mich, sei es eines Umstands, der nicht das Geringste mit ihr selbst zu tun hatte, etwa eines Krieges wegen, oder deshalb, weil sie zu einer verfolgten Minderheit zählte, aus der ihr vertrauten Welt in eine fremde verschlagen hatte und sie sich nun in dieser zurechtfinden, sich, und sei es mit Putzarbeiten, ihren Lebensunterhalt verdienen musste. Vielleicht verfügte sie über eine gute Ausbildung, vielleicht hatte sie früher Kinder unterrichtet. Wir hätten uns unterhalten können. Dazu hätte es allerdings meiner Neugier, meines Wohlwollens bedurft. Aufgewachsen in einer Welt, in der ich, wenn auch einem strengen Reglement unterworfen, stets als eine Art Prinzessin behandelt worden war, ordnete ich sie den Haushaltsgeräten zu.
Die nächste Raumpflegerin war taubstumm. Ich wusste auch diese Gelegenheit nicht wahrzunehmen. Ich hätte mich mit metaphysischer Anatomie beschäftigen, mich fragen können, wie jemand, der über kein Gehör verfügt, den hochmütigsten aller Sinne, die Welt wahrnimmt. Ich hätte mich in Demut üben, die Gebärdensprache lernen sollen. Warum ließ ich sie nicht Geschichten schreiben, anstatt zuzulassen, dass sie den ganzen Tag putzte, den Fußboden von Neuem wischte, kaum war sie damit fertig geworden? Dabei war die Taubstumme von auffallender Schönheit, dem Mädchenalter noch nicht ganz entwachsen. Ihr glatt gescheiteltes Haar, das in einen Zopf auslief, war mit einer durchsichtigen Haube bedeckt, die von einem schmalen schwarzen Band, das in der Mitte der Stirn verlief und am Hinterkopf geknotet war, gehalten wurde. Eine zweifach gewickelte Halskette aus dunkelblauen, vermutlich aus Ebenholz gefertigten Perlen betonte ihr schönes Gesicht. Sie trug ein kostbares, bis auf den Boden reichendes blaues Kleid mit geschlitzten Ärmeln, die innen mit gelbem und rotem Stoff gefüttert waren. Der Ausschnitt, der ihre Brustansätze zur Geltung brachte, war, wenn ich mich recht erinnere, mit einer schwarzen Borte eingefasst. Obwohl eine solche Kleidung ganz im Widerspruch zu all den Vorstellungen stand, die ich von einer Raumpflegerin hatte, mehr noch, bei all den ihr zugedachten Aufgaben nur hinderlich sein konnte, sah ich den Menschen in ihr nicht. Ich sah die vielen Fingerzeige nicht, die mir, von wem auch immer, gelegt wurden.
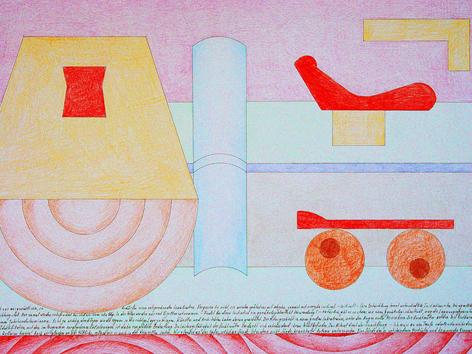 |
Mein Wechsel ins Gartenhäuschen fiel in die Zeit der Taubstummen. Ihre Nachfolgerin war blind. Ich sah sie selten, nur dann, wenn ich kurz in die Wohnung zurückkehrte, um mein Existenzrecht zu behaupten, zu erneuern. Was für ein Versäumnis! Von ihr hätte ich lernen können, Räume anders wahrzunehmen, das zu hören, was hinter den Wänden liegt, in den Tiefen der Räume, ja selbst in der Vergangenheit, Grauenhaftes wie Tröstliches. Übrigens erledigte sie ihre Arbeit besser als alle anderen Raumpflegerinnen, mit denen ich zu tun hatte. Es ist eben ein Unterschied, ob jemand gedankenlos, nur weil es gefordert ist, mit einem feuchten Tuch über eine Tischfläche fährt oder eine solche Bewegung dem kleinsten, für die Augen nicht mehr wahrnehmbaren Schmutz gilt. Allein deshalb kehrte ich hin und wieder in die Wohnung zurück. An versteckten, manchmal schwer zugänglichen Stellen hinterließ ich kleinste Verunreinigungen. Da ließ ich ein Haar fallen, dort tupfte ich mit meinem Lippenstift auf eine Fliese. Kam ich Tage später in die Wohnung, war jede der von mir mutwillig verursachten Verschmutzungen entfernt. Das war mir ein Rätsel. Vielleicht ist sie gar nicht blind, dachte ich mir, spielt nur eine Blinde wie eine Schauspielerin auf einer Bühne. Nein, sie war blind. Einmal hatte ich Gelegenheit, sie in der U-Bahn zu beobachten. Dass ich mich im selben Zug befand, konnte sie nicht wissen. Der Abstand zwischen uns war viel zu groß. Sie konnte mich nicht wahrnehmen. Ihr Blick ging völlig ins Leere. Sie orientierte sich mit ihrem Gehör, bediente sich eines Blindenstocks, um den Boden auf Unebenheiten, Stufen und andere Hindernisse abzutasten. Von all die Raumpflegerinnen, die auf Deborah folgten, hat mich im Nachhinein vor allem sie beschäftigt. Statt sinnlos zu putzen, hätte sie die Rolle der Badedienerin spielen können, die mir anlässlich der großen Feier, des Festes der zusammenprallenden Steine, meinen Kopf kahlschor, mir Achsel- und Schambehaarung (damals hatten sich bestenfalls einige Härchen gezeigt) abrasierte. Sie hätte mich, so wie das Ritual es forderte, waschen und mit kostbaren Ölen salben, meinen nackten Körper in einen Ornat hüllen können. Es hätte nicht einmal eines Ornats bedurft. Eine Tischdecke hätte genügt, um die Szene so lange durchzuspielen, bis ich mir meiner Erinnerung sicher gewesen wäre und vergessen hätte können. Sie hätte sich mit all dem beschäftigen können, was in meinen Körper eingeschrieben ist, mit dem Schmutz, der an mir haftete. Freilich hätten sich meine Narben nicht tilgen, nicht einfach wegwischen lassen. Aber ich stelle mir vor, wie es gewesen wäre, wären ihre Finger, die Augen ins Leere gerichtet, über meine Narben gefahren. Eine kleine Erhebung und Verhärtung nach der anderen. In ihrem Kopf hätte sich eine Landschaft gebildet, die ihr schon nach wenigen Tagen vertraut gewesen wäre. Die Blinde hätte meinem Mund, meinem Gesicht, meinem Körper eine neue Form geben können, hätte sie mich mit ihren Händen berührt, hätte ich mich ihr hingegeben, wären wir in wirkliche Zwiesprache getreten. Sich selbst bezeichnen kann man nicht. Dazu bedarf es anderer. Hätte, hätte, hätte können. Aber daran habe ich nicht gedacht. Dabei fand ich sie sehr hübsch, ja, ich mochte sogar ihren Geruch, mochte die seltsame Art und Weise, wie sie sich bewegte. Sehenden ist das unmöglich. Sie bewegen sich von einem Punkt zu einem anderen, meinetwegen vom Tisch zum Bett. Blinde dagegen bewegen sich im Raum. Das ist etwas ganz anderes. Ich kann mich nicht einmal an den Namen der Blinden erinnern.
Auf die Blinde folgte eine Raumpflegerin, die über keinen Geschmackssinn verfügte, auf diese eine mit tauben Händen. Sie empfand das Glas nicht, das sie in Händen hielt. Ihre Hand, mochte sich diese auch ganz warm anfühlen, ließ mich an die Hand eines Roboters denken, an den künstlichen Arm, den ich letzthin an einer Bar neben mir auf der Theke liegen sah, dessen Finger sich nur dann in Bewegung setzten, galt es, einem der Gäste die Hand zu schütteln. Statt einer Berührung ein mechanischer Griff, was zweifellos sehr viel Übung erfordert. Nicht zu lasch, aber auch nicht zu hart. Auch jener mit den tauben Händen hätte ich meinen Körper anvertrauen sollen. Wie hätte sie meinen Körper mit ihren tauben Händen untersucht? Was hätte ich empfunden, wären ihre Fingerspitzen über oft bearbeitetes Geschlecht geglitten, hätte sie ihre Hand auf meine Stirn gelegt, meine Knie gehoben? Zu meinem größten Bedauern wusste ich all diese Gelegenheiten nicht wahrzunehmen, hätte ich doch so manches aus meiner Vergangenheit und aus meinem neuen Leben anders sehen können. Sich selbst bezeichnen kann man nicht. Dazu bedarf es anderer. Was für ein Versäumnis! Eine andere Frage drängte sich mir damals auf: Bin ich Gegenstand eines Experiments? Ich wusste es nicht.[1]
Immer wieder trieb es mich in Kirchen, in Messen. Teilgenommen, das wäre zuviel gesagt. Teilnehmen kann nur, wer teil hat, Teil ist. Wer mit fremden Augen betrachtet, kann nicht teilnehmen. Verließ ich eine Kirche, als hochgemut empfand ich mich nie. Im Gegenteil, stets überfiel mich das Gefühl einer großen Leere. Die Wirkung des Erlebten war alles andere als ungeheuer.[2] Geradezu als ungeheuerlich empfand ich die Leere. Einmal wurde ich in ein Nonnenkloster eingelassen. Womit waren die Nonnen in den Stunden, die nicht dem Gebet oder der Arbeit galten, beschäftigt? Mit der Anfertigung von Puppen. Puppen, Puppen, Puppen. Puppen aus ausgestopften und zurechtgebogenen, zurechtgeformten Damenstrümpfen. Aufgenähte Knopfaugen. Haare aus Wollfäden. Geschminkte Bäckchen, mit Wasserfarben aufgetragene Mündchen. Wäre es nur lächerlich gewesen, es hätte mich nicht berührt. Es war traurig. Die Oberin zeigte mir mit ihren langen Fingern, die mich an Spinnenbeine denken ließen, inmitten ihrer kleinen Schwesternschar eine Puppe nach der anderen, all die hässlichen Geschöpfe. Auf einer Couch, auf Polster gebettet, an Kissen gelehnt, viele dieser Puppen, voneinander kaum zu unterscheiden. Musste an verödete Keimanlagen denken, an ein irregeleitetes Begehren, welches sich nur grotesk zu entfalten vermag. Unter den alten Nonnen saß etwas abseits eine junge Nonne mit fleischigem Bauerngesicht. Schmollend. Die Oberin meinte, ich solle sie gar nicht beachten. Nicht beachten, ihr keine Aufmerksamkeit schenken, so tun, als existiere sie nicht, als sei sie nicht anwesend, als sei sie nur hingepinselt. Immer wieder gäbe es Probleme mit ihr. Unlängst sei sie wieder weggelaufen. Dabei wisse sie nicht einmal, wohin sie wolle. Stets werde sie aufgegriffen und wieder zurückgebracht. Dann schmolle sie einige Tage. Es sei nicht leicht mit ihr. Als ich versuchte, mit dieser Nonne in ein Gespräch zu kommen, wurde ich von der Oberin am Arm gefasst und durch lange Gänge, in denen es unangenehm nach Klosterküche, nach fettem Essen und Putzmitteln roch, ein unverwechselbarer, nur solchen Häusern eigener Geruch, bis zum Ausgang begleitet. All das ist jetzt Jahre her. Grauenhaft, denke ich an die vielen Puppen, die in der Zwischenzeit hinzugekommen sein mögen. Die widerspenstige Nonne, die ich damals gern in meine Arme genommen und an mich gedrückt hätte, wird sich in ihr Schicksal gefügt haben und nun auch mit Puppen beschäftigt sein.
Um Ordnung in meine Gedanken zu bringen, gewöhnte ich es mir an, jeden Tag einen längeren Spaziergang durch das Katzenloch zu machen. Ich nahm stets denselben Weg, entlang des steil abfallenden Baches, den Erlen, Haselnusshecken, rote Heckenkirschen und dergleichen säumten. Das botanische Jahr beginnt mit dem Seidelbast. Es folgen Leberblümchen, die ersten Farnknospen. Kaum haben sich Adler- und Wurmfarn entfaltet, blüht der Geißbart. Im Wochenrhythmus wechseln diese oder jene Blüten, das Waldvöglein, die ästige Graslinie, der quirlblättrige Weißwurz, der vielblütige Weißwurz, das schwarzfruchtige Christophskraut, der rundblättrige Steinbrech, der Braunwurz. Mein Interesse für Botanik verdankt sich meiner Geschichte. In meiner Kindheit war viel von Pflanzen die Rede, von Pflanzen, die wir uns zum Vorbild nehmen sollten. Nun kam etwas anderes hinzu, nämlich das Bedürfnis, eine gewisse Ordnung, eine Systematik in der Welt zu erkennen. An einer Stelle musste man sich, wollte man den tief unten rauschenden Bach queren, über eine Hochdruckleitung eines Elektrizitätswerkes wagen, ein Balanceakt, der Konzentration voraussetzte, besonders an Regentagen, an denen das gusseiserne Rohr wenig Halt bot.
Mitten im Wald, von mächtigen Buchen beschattet, von Blutbuchen, die mich an meine Kindheit denken ließen, eine kleine Wallfahrtskirche aus dem achtzehnten Jahrhundert. Noch heute deponieren Menschen hier ihre Nöte. Es bräuchte viele solche Orte, um Sorgen abzulegen, um innezuhalten. Manche beten um Nachwuchs. Will man den vielen Votivtafeln, die an den Wänden hängen, Glauben schenken, dann wurden die Gebete nicht weniger Frauen erhört. Gott ist mir fremd. Das Gnadenbild, das eine Madonna mit dem Christusknaben zeigt, nichts als ein Gemälde. Ich weiß es ikonographisch wie kunsthistorisch zu deuten. Und doch betrat ich während meiner Spaziergänge immer wieder die Kirche, um genauer zu sein, ich suchte sie auf. Manchmal zündete ich eine Kerze an, hielt einige Minuten inne, um an Menschen zu denken, die mir wichtig waren. Es waren nicht viele, deren Gesichter ich vor mir sah. Ich dachte an die vielen, denen ich Mutter bin, deren Namen ich nicht kenne, deren Existenz ich nur vermuten kann. An gesichtslose Wesen, ebenso gesichtslos wie all die armen Seelen, für die andere in eben dieser Kirche zahllose Gebete sprachen. Ich vergaß selbst jene nicht, die etikettiert in flüssigem Stickstoff vorrätig gehalten werden. Ohne jedes Bemühen, mich zu konzentrieren. Fiel sie mir ein, nannte ich auch den Namen der Großen Mutter, die im Park unnahbar mit ihrem Hofstaat einher schritt. Warum sollte man in solchen Augenblicken nur an jene denken, die einem gewogen sind? Ich warf eine Münze in den Opferstock, griff nach einem Wachslicht, stellte es in die Halterung, nahm ein Streichholz, zündete es an einer der brennenden Kerzen an und hielt es an den Docht meines Wachslichtes, um dann auf das Gnadenbild zu blicken, nein, nicht auf die Mutter Gottes, sondern auf einen Schafe hütenden Jungen, der am Bildrand zu sehen ist. Mir wären andere Dinge durch den Kopf gegangen, hätte ich kein Geld in den Opferstock geworfen, keine Kerze angezündet, nicht auf den Jungen mit den Schafen geblickt, hätte ich mich nicht bereits während des Spazierganges den Bach entlang auf eben diesen Augenblick eingestimmt.
Eigenartig. Es gibt kaum einen Ort, mit dem mich so viele Erinnerungen verbinden. Angenehme Erfahrungen, aber auch schauerliche. Der erlebte Schrecken gräbt sich tiefer in unser Gedächtnis ein als jedes Glücksempfinden. Einmal, als ich die kleine Kirche betrat, waren auf den abgetretenen Steinplatten blutige Schleifspuren und Schuhabdrücke zu sehen. Frisches Blut. Eine große Blutlache. Die Kirche stand leer, die Tür offen. Wie ich wenig später erfuhr, hatte ein verwirrter Mann, er hatte eben eine langjährige Haftstrafe verbüßt, mit einem Messer auf eine junge Nonne, die ins Gebet vertieft auf einer der Bänke saß, eingestochen. Im selben Augenblick, als ich bestürzt die blutverschmierten Steinplatten betrachtete, mich fragte, was hier wohl geschehen sei, lief eben dieser Mann auf einem nahegelegenen Feld zwei Polizisten entgegen. Er wurde erschossen. Dabei war er unbewaffnet. Sein Messer hatte er längst weggeworfen. Noch ehe das Blut der Nonne getrocknet war, lag er selbst tot in seinem Blut. Ich hörte die Schüsse, machte mir aber keine Gedanken, da Schüsse im Katzenloch nicht ungewöhnlich sind, auch Füchsen oder streunenden Hunden gelten können. Eine Zeitgleichheit, um die ich erst später wusste. Die Nonne überlebte den Angriff. Sie hat nichts verstanden. Immer noch sucht sie, nun in Begleitung anderer, die Wallfahrtskirche auf, um Schutz und Beistand der Madonna zu erflehen. Anders als ich betrachtet sie das Gnadenbild als Lebewesen, als buchstäbliche Verkörperung der Jungfrau der Jungfrauen, der unversehrten und unbefleckten Mutter. Warum sich nicht Mariens Obhut anvertrauen, der Himmelskönigin, ohne Makel empfangen? Ich gäbe einiges dafür, wüsste ich um die Gedanken der jungen Nonne, die ihr damals durch den Kopf gingen, auch um die des entlassenen Sträflings, als er sie in der Kirche knien sah und sich ihr näherte. Womöglich ließe sich im Denken eine Verzahnung feststellen.
Ein anderes Bild. Tiefster Winter. Es war nicht jener schneereiche Winter, in dem ich tagelang auf den Abgang einer mächtigen Lawine wartete. Damals wollte ich aus nächster Nähe erleben, wie sich in den Felswänden Schneemassen lösen und sich mit lautem Getöse durch das Katzenloch schieben. Ich sah den Abgang nicht. Nur wenige Meter von der vermeintlich sicheren Stelle wurde eine ältere Frau von der Lawine erfasst. Erst Monate später aperte ihr Leiche aus. Nein, es war nicht dieser Winter. Dichtes Schneetreiben hatte allen Lärm der nahen Stadt zum Verstummen gebracht. Nicht einmal ein Flugzeug war zu hören. In meine Gedanken versunken, stapfte ich, ohne einem Menschen zu begegnen, durch den Schnee der Kirche zu. Plötzlich wurde ich auf einen Hund aufmerksam, der mich, einen großen Abstand wahrend, umkreiste. Ein streunender Hund, ein hungriger Hund, der Annäherung suchte. Ein Hund, Menschen entlaufen, nun wieder die Nähe eines Menschen suchend, der ihn aufnehmen und füttern möge.
Eine andere Hundegeschichte. Nicht unweit der Kirche lag in einer Lichtung ein Ausflugsgasthaus. Lange ein wichtiger Fluchtpunkt in meinem Leben. An einem verregneten Herbstmorgen wollte ich auf der Veranda dieses Gasthauses einen Kaffee trinken. Das Gasthaus hatte noch geschlossen. Mit dem Rücken an das Geländer der menschenleeren Veranda gelehnt, sah ich einen großen schwarzen Schäferhund leichtfüßig auf mich zutraben. Kaum hatte er mich erreicht, richtete er sich auf und stützte sich mit seinen Vorderpfoten neben mir auf das Deckbrett des Geländers. Wir blickten uns an, schauten uns in die Augen, mag das für einen Hund auch ungewöhnlich klingen. So, als hätte er Zutrauen zu mir gefasst, tatsächlich war ich es, die sich fürchtete, rückte er seitlich näher und näher, bis wir beide Körper an Körper standen. Er schmiegte sich mit seinem nassen Fell ganz eng an mich, legte seinen Kopf in einer wahrlich zärtlichen und befremdlichen Geste in meinen Nacken, in den offenen Kragen meiner Jacke. Er tat dies so vorsichtig, dass ich jede Angst vor ihm verlor, obwohl ich seine Zähne an meinem Hals wusste und sein hechelndes Atmen ganz nah an meinem Ohr zu hören war. Er schmiegte sich an mich, verstärkte sanft den Druck auf meinen Körper. Minutenlang standen wir so aneinander gelehnt, ich und dieser Hund. Sanft fuhr ich über seinen Kopf und Nacken, fasste, so wie Liebende es tun, um seine Hüften. Eigentlich mag ich Hunde nicht, aber in diesem Augenblick schien mir dieser Hund so schön, so männlich, so schwarz, und doch so sanft und zärtlich, dass ich mich ihm hingegeben hätte, wären die anatomischen Voraussetzungen gegeben gewesen, hätte ich ein solches Ansinnen nicht doch als etwas lächerlich empfunden. Ich schaute ihn lange an und meinte: „Du und ich, wir müssen uns entscheiden.“ Kaum hatte ich das gesagt, löste er sich von mir. Er verschwand, so wie er aufgetaucht war, im dichten Nebel. Er verschwand im Wald, von dem ich hier erzähle.
In der Gaststube des Gasthauses hing ein großes Ölgemälde aus dem späten neunzehnten Jahrhundert. Kein Meisterwerk. Es zeigte ein Kurhotel in einer Parklandschaft mit all seinen Nebengebäuden. Palmen. Nicht ein Mensch war darauf abgebildet. Vor dem breiten Stiegenaufgang stand nicht einmal ein Fuhrwerk. Vielleicht gefiel mir dieses Gemälde eben deshalb, womöglich erinnerte es mich an den Park. Ich wollte das Gemälde kaufen. Der Besitzer schien nicht abgeneigt. Er werde es sich überlegen. Er versuchte den Preis in eine Höhe zu treiben, die dem Wert des Gemäldes keinesfalls entsprach. Schließlich einigten wir uns. Als ich wenige Tage später auf die Lichtung trat, ich hatte das geforderte Geld eingesteckt, sah ich vor mir nur noch eine Brandruine. In den Trümmern gloste da und dort noch Glut. Löschwasser verdampfte. Wenige Tage später wurde der Besitzer der Brandstiftung überführt. Warum hatte er mir das Gemälde nicht vorher verkauft?
Die Kreise des Hundes, der im tiefen Schnee um mich herumlief, bemüht, sich mir anzunähern, wurden enger. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis er sich winselnd an meine Beine schmiegen würde. Doch plötzlich, ich hatte die Kirche fast erreicht, ein lauter Knall, ein Schuss. Der Hund bäumte sich vor meinen Augen auf, um dann jaulend, sich im steilen Gelände mehrfach überschlagend, in den Schnee zu fallen. Sein Jaulen verebbte in einem Winseln, das bald erstarb. Und schon war es wieder still, ganz ruhig, so als wäre nichts geschehen. Obwohl der Schuss in nächster Nähe abgefeuert worden war, der Knall war ohrenbetäubend, war kein Mensch zu sehen. Es zeigte sich niemand. Gut möglich, dass der Schuss mehr mir gegolten hatte als dem Hund, waren doch genügend Tafeln aufgestellt, auf denen zu lesen stand: „Frei laufende Hunde werden erschossen!“ Ich watete zwischen Buchen, mich an Untergehölz festhaltend, durch den tiefen Schnee den Abhang hinunter, dorthin, wo ich den Hund liegen sah. Mit seinen letzten krampfartigen Bewegungen hatte er den frischen Schnee aufgerührt, seinen Kopf in den Schnee gegraben. Blut im weißen Schnee. Der Hund war tot. Ich griff nach seinem Kopf, wischte mit etwas Schnee den Schädel ab. Ich wollte das Gesicht des Hundes sehen, wissend, dabei von jenem beobachtet zu werden, der ihn getötet hatte. Die Augen starrten ins Leere. Dann stapfte ich auf den Weg zurück. Der Tod dieses Hundes berührte mich. Geweint habe ich nicht.
Ein eigenartiger Traum: Zuerst brachte die Katze eine Ratte und legte sie mir vor die Füße. Die Ratte in ihrer Angst, gefressen zu werden, kletterte an mir hoch. Später war ich bei Freud in Behandlung. Ein sehr alter Mann, dünn zwar, geradezu mager, aber keine Spur von krank. Er wohnte bei seiner erwachsenen Tochter, die allerdings nichts mit Anna Freud zu tun hatte, sondern eher an eine gut situierte Geschäftsfrau aus der Altstadt denken ließ. Dass ich in die Analysestunde kam, schien sie nicht zu begeistern, auch nicht, dass Freud sich immer noch mit Patienten abgab. Freud begleitete mich, kaum hatte er mir die Hand gereicht, in sein Arbeitszimmer. Aber da stand keine Couch. Ein nahezu leerer Raum. Ich war verunsichert, wusste nicht, welchen Platz ich einnehmen sollte. Als Freud meine Ratlosigkeit bemerkte, meinte er: „Ich habe es mir angewöhnt, auf dem Boden zu sitzen.“ Er wies auf einen am Boden liegenden Polster. Ich solle mich ausziehen. Ich zog mich bis auf mein Höschen aus. Auch Freud zog sich aus. Ich betrachtete seine abgemagerten Beine. Während ich vor mich hin sprach, all das sagte, was mir eben einfiel, ohne auf den Sinn des Gesagten zu achten, streichelte er meine Knie. Ich fuhr zärtlich über die ausgetrocknete Haut seiner Unterschenkel, die er auf meine Beine gelegt hatte. Ein sehr angenehmes Gefühl. Plötzlich versuchte er eine Deutung und sagte: „Es ist eigenartig, Sie betonen einzelne Worte so, als hätten sie mit dem Übrigen nichts zu tun ...“ Er versuchte mich zu küssen. Nicht auf den Mund, sondern auf Stirn und Schläfen, so wie Eltern es tun, die ein Kind zu Bett bringen. Ich sträubte mich, dachte an Freuds Zungengrund, an all die Operationen, die in seinem Mund durchgeführt worden waren. Später, ich hatte Freuds Wohnung bereits verlassen, fiel mir ein, dass ich nicht bezahlt hatte. Mit einem schlechten Gewissen ging ich abends noch einmal hin. In seiner Wohnung war ein Fest im Gange. Es fand sich keine Gelegenheit, Freud den Geldbetrag zu überreichen. In meiner Aufregung verschüttete ich Bier, oder genauer gesagt, ichASFG goss das Bier, ohne mich zu bücken, aus einer Flasche in ein aufrecht am Boden stehendes Glas. Der Schaum stieg höher und höher, breitete sich über die Teppiche aus.[3] Freuds Tochter, die tüchtige Bürgersfrau, machte ihrem Unmut Luft: „Nicht einmal Bier einschenken kann sie sich!“ Beim Verlassen der Wohnung fiel mir das Türschild auf: „Bischof von Aleppo. Hüter der reinen Ordnung. Sprechstunden ...“
Ein Idyll, wie einem Kinderbuch vergangener Tage entnommen. Ein Stadtausschnitt, ins Übersichtliche, ins Dörfliche neigend. Überschaubar. Da die Tankstelle, dort die Bäckerei, daneben ein Hutmacher, angrenzend ein Gemüsegeschäft, in dessen Auslage Kisten mit Tomaten, Karotten, Kartoffeln, Äpfeln und Birnen zu sehen sind. In der Auslage der Fleischerei Würste und Schweinehälften, an Haken hängend. Durch ein anderes Schaufenster ist ein Friseur beim Rasieren eines älteren Mannes zu sehen. Eine Eisdiele, ein Café, eine Bushaltestelle. Ein Telefonhäuschen darf nicht fehlen. Aber nicht ein einziges Auto ist zu sehen. Überhaupt liegt eine gespenstische Trägheit über dem Ganzen, obwohl Menschen in Bewegung sind, ältere Menschen. Kinder fehlen. Es ist, als seien in dieser Stadt alle unfruchtbar geworden. Blickt man jedoch genauer hin, sind, wenn auch wenige, so doch jüngere Menschen zu erkennen. Sie alle sind weiß gekleidet. Man sucht dem Bewegungstrieb der Kranken mit Hilfe der Simulation zu begegnen. Betrachtet man das Idyll in der Schrägaufsicht, dann tritt es plötzlich zutage: Man hat Bahnen mit Bushaltestellen oder ähnlichen aus dem Alltag bekannten Wegmarken angelegt. In der Auslage des Gemüsegeschäftes liegt weder Obst noch Gemüse. Eine solche Fleischerei gibt es längst nicht mehr. Es wird nur so getan. Wie vor langer Zeit lassen sich in der Telefonzelle Münzen einwerfen, aber legt man den Hörer ans Ohr, so ist stets gleichbleibend zu hören: „Bitte haben Sie etwas Geduld. Ihr Gesprächspartner wird sich in Kürze melden. Bitte haben Sie etwas Geduld, Ihr ...“ Es gibt zwar eine Bushaltestelle, selbst Fahrpläne, aber Bus fährt keiner. Demenzkranke bewegen sich in Achterschleifen, ohne sich daran zu erinnern, die Bushaltestelle oder das Café schon mehrfach passiert zu haben. Ins Leere laufen, sich leerlaufen. Von einem Leerlauf spricht man, läuft eine Maschine, ohne jene Arbeit zu verrichten, für die sie vorgesehen ist. Bedrückend der Eifer, mit dem sich einzelne Kranke buchstäblich zu Tode laufen. Im Ballspielen brachten wir es zu einer bewundernswerten Meisterschaft. Auch ein wohl kalkuliertes Leerlaufen. Ich musste an ein Schmetterlingshaus auf einer botanischen Insel denken, ein beliebtes Ausflugsziel junger Paare. Vor der Eingangstür eine lange Warteschlange. Ist die Höchstzahl an Besuchern erreicht, gibt das Drehkreuz, das Gatter, nur dann den Weg frei, wenn ein anderer Besucher das Schmetterlingshaus verlassen hat. Und ist der Besucher eingetreten, so bewegt er sich auf schmalen Pfaden in stickiger Luft durch üppiges Grün, unter Palmblättern, durch Farne und anderes Urwaldgestrüpp, das Kopf, Schultern und Beine streift. Er wird fortbewegt von der schiebenden Besuchermasse. Bliebe man stehen, alles geriete ins Stocken. Nach einer gewissen Zeit kam mir alles merkwürdig bekannt vor. Es schien mir, als seien mir diese oder jene Gesichter bereits begegnet, als hätte ich mich schon an dieser oder jener Stelle befunden. Ich täuschte mich nicht. Der Pfad durch das Grün ist als Schleife angelegt, auf der man läuft und läuft, so lange, bis man sich dessen bewusst wird und nach einem Ausgang sucht. So lässt sich Raum sparen, kann man auch die Körperwärme, die Ausdünstungen der Besuchermasse zur Simulation des tropischen Klimas nutzen. Fragte mich einer nach den Schmetterlingen, die ich dort sah, ich wüsste nur wenig zu sagen. Groß waren die meisten von ihnen, vor allem bunt. Auch dass sie sich zu Tode fliegen. Ich habe Aufnahmen von einem Mädchen gemacht. Es kniete auf dem mit Kopfsteinen gepflasterten Pfad und betrachtete fasziniert Schmetterlinge, die sich auf seinem ausgestreckten Arm niedergelassen hatten. Ganz versunken schien das Mädchen in der Urwaldwelt. Dabei waren weder Baumschlangen noch Jaguare zu vermuten, nicht einmal Moskitos, deren Sirren sich einer Endlosschleife auf einem Tonband verdankte, wie auch andere Geräusche des Urwalds, vor allem das Gekreisch von Vögeln. Dass sich die Schmetterlinge zu Tode fliegen, sich nicht einmal fortpflanzen können, daran dachte das Mädchen gewiss nicht. Wegwerfschmetterlinge, ähnlich produziert wie Hummelvölker zum Bestäuben von Blüten in Gewächshäusern. Auf einer Tafel stand zu lesen: „Berühren Sie die Schmetterlinge nicht, damit sie länger leben!“ Es müsste lauten: „Berühren Sie die Schmetterlinge, damit sie kürzer leben!“ Wohl kaum ein Besucher denkt daran. Die Schmetterlinge sind einfach da. Es scheint, als lebten sie ewig. Dass sie kontinuierlich ersetzt werden, ersetzt werden müssen, das sieht der Besucher nicht. Sähe er es, dann betrachtete er die lange Warteschlange vor dem Eingang anders, sähe er sich nicht viel anders bewirtschaftet als die Schmetterlinge, die er bewundert.
Musste an folgendes Bild denken: Ein Fluss, in ein festes Bett gezwängt, ergießt sich in die Abtei, treibt die Getreidemühle an, schüttelt das Sieb, um das Mehl von der Kleie zu trennen. Auf die Getreidemühle folgt die Walkmühle. Hier heben und senken sich abwechselnd schwere Hämmer und Schlegel. Nun verzweigt sich der Fluss in viele kleine Arme, um da und dort Räder in eine rasche Bewegung zu versetzen. Schäumt er am Ende der Anlage, so ist es, als hätte er sich selbst gemahlen.[4] Und haben sich seine Arme wieder zu einem mächtigen Fluss vereinigt, trägt er, um nichts ungetan zu lassen, den Abfall mit sich fort und lässt alles sauber zurück, trägt Kot aus Abteien, Unrat aus Abdeckereien, Fabriken und Städten mit sich fort, um sich später auf fruchtbares Land zu ergießen und dieses noch fruchtbarer zu machen. So erfährt das Ausgeschiedene seine Reinigung, um dann als Getreide, Obst, Gemüse und Fleisch wieder in die Mägen der Mönche oder Stadtbewohner zu gelangen. Ein endloser Kreislauf, der sich in Gang setzen lässt, vorausgesetzt, Kanalsysteme, Eisenbahnlinien oder Geräte, um Fäkalien auf den Feldern auszubringen oder das Getreide zu ernten, sind vorhanden. Kläranlagen, die der Fischzucht, der Ernährung dienen. Auch eine Endlosschleife. Ohne jeden Leerlauf. Ob Kühe, junge Mädchen oder Embryonen, einen Stillstand darf es nicht geben.
In einer Warteschlange ein junger Mann, der mit seinem Kopf eine stets gleichbleibende Drehbewegung ausführte. Wohl Folge einer Gehirnverletzung. Sein Gesicht strahlte Glück aus, geradezu ein Lustgefühl, das man nur selten in einem Gesicht sehen wird. Als ich ihn ansprach, riss ich ihn aus seinem Glück. Kaum hatte ich von ihm abgelassen, setzte sich sein Kopf wieder in eine kreisende Bewegung. Nur einmal sah ich ein ähnliches Gesicht, das Gesicht eines etwa zwölfjährigen Jungen in einer psychiatrischen Pflegeanstalt. Raimund, Kind eines Schwarzen und einer jungen weißen Frau. Ein Kind mit dunkler Hautfarbe, mit dichtem krausem Haar. Schwarzes Haar. Ein ungewolltes Kind, ein überflüssiges Kind, ein verstoßenes Kind, ein in einer Entsorgungsanlage verwahrtes Kind. Und doch schien mir Raimund glücklich. Sein ganzes Gesicht strahlte, ließ er im eingezäunten Gehege seinen Kopf kreisen, zog er zwischen den Fingern der linken und rechten Hand kunstvoll Spuckefäden und betrachtete diese mit nach oben gerichteten Händen gegen das Sonnenlicht. Raimund lebte in seiner eigenen Welt. Ach, könnte ich die Welt nur einmal mit seinen Augen sehen, all ihre Schatten, das Licht der Sonne, gebrochen durch Spuckefäden, blinzelnd, mich drehend, in Trance. Leider gingen die Filmaufnahmen, die ich damals machte, auf einer meiner vielen Fluchten (vor mir selbst) verloren. Nein, in die Sonne blickte Raimund gewiss nicht. In jeder seiner Drehbewegungen fiel ihr Licht nur den Bruchteil einer Sekunde in seine Augen. Was sah er? Ein Lichtspiel? Möglich. Vielleicht aber doch etwas ganz anderes. Er konnte keine Auskunft geben. Da niemand mit ihm gesprochen hatte, hatte er nie sprechen gelernt. Und doch konnte er Glück empfinden. Das Glück. Aber was ist schon Glück? Mit der Welt der anderen hatte er nur dann zu tun, wurde er gewaschen, gekleidet und gefüttert, oder aber dann, wenn alte Männer im Gehege an seinen Genitalien nestelten, er von einem in eine dunkle Ecke gezerrt, in die Toilette gedrängt, von hinten genommen wurde, um ihn für die Abwesenheit des weiblichen Geschlechts büßen zu lassen. Besonders drangsaliert wurde er von einem Kranken, der traumatisiert aus einem Krieg zurückgekehrt war und in der Rolle eines amerikanischen Generals auftrat. Während der Visite hatten die Ärzte anzutreten und ihm Meldung zu machen. Dabei war es völlig gleichgültig, was sie sagten. Sie hätten auch einige Zeilen aus einem Telefonbuch, eine Speisekarte, Verkehrsregeln oder Beipackzettel von Medikamenten herunterbeten können. Es kam nur auf die Gestik an, auf die Habtachtstellung. Hatten die Ärzte ihre Meldung gemacht, brachen sie zum Vergnügen der Anwesenden in Gelächter aus. Auch der General lachte.
Raimund ließ all das, was ihm geschah, über sich ergehen. Er war es gewohnt. Er kannte keine andere Welt, nahm all das, was ihm geschah, als gegeben hin. Aber es gab die Sonne. Er wusste, sie würde auf ihn warten, sein Zauberspiel nur für kurze Zeit unterbrochen sein. Man hatte den Jungen lebendig begraben. Und doch war er in einem gewissen Sinn glücklich. Vielleicht verdankte sich sein Glück, es war wohl so, einzig der Welt, die er sich geschaffen hatte: eine Welt aus Spuckefäden, die zwischen den Fingern die seltsamsten Figuren lebendig werden ließen. Es gab niemanden, der durch sein Haar strich, der ihn in seine Arme nahm und liebkoste. Dabei war Raimund ein hübscher Junge. Aber jeder, sieht man vom General und anderen älteren Insassen ab, ekelte sich vor dem Geruch nach getrockneter Spucke. An Regentagen verkroch er sich im Wäschekorb, in Leintüchern, die mit Kot, Urin oder Erbrochenem beschmutzt waren. Ich mochte ihn.
Heute bedaure ich es, mich nicht ein einziges Mal mit Raimund im Korb mit der schmutzigen Wäsche verkrochen zu haben. Wie Raimund lebe auch ich in einer eigenen Welt, in einer Welt, in die ich von anderen mutwillig hineingestoßen wurde. Wie Raimunds Seele ist auch meine gezeichnet. Auch ich drehe mich im Kreis, in endlosen Kreisbewegungen, die mich schwindelig machen, durch einen Wald von Spuckefäden. Ich beherrsche Raimunds Kunstfertigkeit nicht. Warum wurde ich nicht einfach eingeschläfert, nicht einfach aussortiert, als man mich flüssigem Stickstoff entnahm. Ich hätte nichts dagegen, hätte man mich geschlachtet wie eine Kuh, die nicht mehr aufnehmen will. Kühe gehen gerne bergwärts. Ein leicht ansteigender Boden hätte mir den Weg gewiesen. Kein rechter Winkel, nicht eine einzige eckige Kante hätte mich verwirrt. Am Ende eines dunklen Ganges ein helles Licht. Auf dieses Licht hätte ich mich zubewegt, dies in der Gewissheit, eine breite Tallandschaft mit saftigen Wiesen liege vor mir. Das Ansetzen eines Bolzenschussapparates hätte ich nicht bemerkt, oder er wäre mir wohl nur als flüchtiger Schatten erschienen, hätte doch nach einer engen Kurve ein Hindernis, das meinen Weg versperrte, meine ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Will man den Veterinärmedizinern und Tierschützern glauben, dann soll es ein schmerzloser Tod sein. Ein Bolzenschussapparat würde angesetzt. Es würde ‚päng‘ machen und ich zu Boden stürzen. Geschähe nichts weiter, ich würde nach einer Zeit erwachen, mir meiner selbst wieder bewusst werden und versuchen, trotz aller Benommenheit auf die Beine zu kommen. Aber lange bevor sich auch nur eines meiner Lider geöffnet hätte, hätte einer durch das kleine Loch eine Drahtfeder in mein Gehirn geschoben, tief in den Rückenmarkskanal, einmal kräftig gerührt wie in einem verstopften Abflussrohr. So geschieht es heute nicht mehr. Einer, der den ganzen Tag nichts anderes macht, schieben sich doch endlos Tiere nach, würde meinen Hals öffnen, damit alles Blut aus mir fließe.
Meine Begegnung mit Raimund liegt lange zurück. Jahre später trieb es mich, ihn noch einmal zu sehen. Dort, wo sich früher das Gehege befand, in dem ich ihn erstmals sah, stand nun ein modernes Gebäude, das an eine Hotelpension denken ließ. Kleine Zimmer, alle von den Gängen aus durch große Glasscheiben einsehbar. Gespenstische Ruhe. Kranke, mit Medikamenten ruhiggestellt. Die meisten von ihnen lagen in ihren Betten und warteten, ohne dies zu wissen, auf ihren Tod. Kein Schmetterlinge flogen durch die Zimmer. Bushaltestellen oder Telefonhäuschen waren hier nicht vorzutäuschen. Wozu auch? Solches kannten diese Kranken auch in ihrem früheren Leben nicht. Vorrätig gehalten werden sie nicht. Zu welchem Zweck auch? Sie werden in einer hygienischen, geradezu aseptischen Welt zu Tode gefüttert, mit breiiger Nahrung und Medikamenten, eingegeben oder ins Essen gemischt. Hier hatte Raimund nicht mehr zu befürchten, in eine Toilette gezerrt zu werden. Die Sonne durch Spuckefäden zu betrachten, das war nun aber auch nicht mehr möglich. Ich fand ihn in einem der Krankenzimmer. Er war groß geworden. Ein junger Mann. Obwohl abgemagert und kraftlos, hatte er noch etwas von seiner früheren Schönheit. Seine Arme lagen schlaff auf dem Bettzeug. Sein Blick war teilnahmslos gegen die Zimmerdecke gerichtet. Ich setzte mich auf den Bettrand, nahm seine Linke, legte sie auf meinen Schoß, erzählte ihm vom Farbenspiel der Spuckefäden, der Sonne, davon, wie er langsam mit erhobenen Armen und Händen um die eigene Achse tanzte. Alles Eigenleben war aus ihm verschwunden. Als mir Tränen über die Wangen liefen, ließ ich ihn allein zurück.
Ich sitze in einem Lokal und schaue durch große Glasscheiben auf einen Platz, der von vielen Menschen frequentiert wird. Junge Frauen. Ich beneide sie um ihre Naivität. Ich beneide selbst jene, die sich nicht anzuziehen wissen, die kokett einhergehen, um auch noch dem Dümmsten zu gefallen. Als ich in ihrem Alter war, zählte ich bereits seit Jahren zu den besten unter den Geweihten. Damals war ich in Höchstform, mochte ich auch nicht wirklich wissen, welchem Zweck dies diente. Kaum eine der Frauen, die ich durch das Fenster beobachte, käme in Betracht. Zu dick, zu dünn, zu flache Brüste, Rumpf und Beine unproportioniert. Ein ungelenker Gang. Aufgewachsen in einer Welt, in der es nur schöne Körper gab, bin ich oft genug von der Hässlichkeit junger Frauen entsetzt. Sind sie wirklich hässlich oder ist nur mein Blick verdorben? Jedes behauptete Ideal verdankt sich Abweichungen, ebenso wie es Abweichungen zur Folge hat. Gäbe es nur schöne Menschen, niemand spräche von schönen Menschen. Ohne Hässliche gäbe es sie nicht. Ich brauchte lange, um anzuerkennen, dass auch hässliche Menschen schön sein können. Schönheit aus dem Warenkatalog. Dagegen Schönheit, die sich Erfahrungen, dem Leben verdankt. Das Leben kann aber auch hässlich machen. In den Augen des Parks wären viele zu löschen, zu tilgen, auszumerzen. Schaue ich genauer hin, dann scheinen mir manche der jungen Frauen, die ich durch die Glasscheibe des Lokals betrachte, sehr tapfer zu sein. In Gedanken begleite ich sie ein Stück ihres Weges.
Einer der ersten Frühlingstage. Die Sonne trieb mich an den Stadtrand. Unweit eines Parkplatzes sah ich im noch unbelaubten Gebüsch erste Veilchen. In das Pflücken von Veilchen versunken, wurde ich durch eine Stimme aufgeschreckt. Ein kleiner Mann mit dunklem Hut, den ich durch all die Zweige nur ungenau sah: „Warum suchen Sie hier, in all dem Unrat, wo überall Kot von Menschen und Hunden zu sehen ist? Gehen Sie doch hinüber zum Fuß des Hügels, auf dem die Marienkapelle steht. Dort werden Sie die schönsten Veilchen finden.“ Eine angenehme, eine wohlwollende Stimme, die mir bekannt schien. Aber ich konnte sie mit keinem Menschen, mit dem ich in meinem Leben zu tun gehabt hatte, in Verbindung bringen. Noch ehe ich antworten konnte, war der kleine Mann mit dem Hut in den Gemüsefeldern, die hier ihren Anfang nehmen, verschwunden. Wenn ich mich nicht irre, dann mit einem Kichern. Er hatte recht. Am Fuße des Hügels fanden sich ganze Teppiche blühender Veilchen. Ich ließ mir Zeit, auch in der Hoffnung, ihm noch einmal zu begegnen. Um nach ihm Ausschau zu halten, stieg ich auf den Hügel. Von oben sah ich ihn zurückkehren. Er sah auch mich. Ich winkte. Er winkte mit seinem Hut zurück.
Es wäre nutzlos gewesen, hätte mich Paul auf seinem Rücken durch den frisch gefallenen Schnee getragen. Unsere Liebe hätte sich nicht verheimlichen lassen. Es gab zu viele Augen, zu viele Passagepunkte. Zweifellos hat ein Computerprogramm bereits früh Alarm geschlagen. Es bedurfte keiner Wächter. Niemand blies mit einem Muschelhorn Alarm. Waren doch selbst die routinemäßig erhobenen Laborwerte beredt. Dennoch eine schöne Vorstellung, Zeichen- und Spurenleser zu täuschen, indem man sich vom Geliebten durch frisch gefallenen Schnee tragen lässt.[5] Paul hat mich oft auf seinen Rücken genommen, nie aber, um etwas zu verheimlichen. Er wusste besser als ich, dass sich nichts verheimlichen lässt. Wir hätten uns weder verstecken noch fliehen können. Wo hätten wir uns verstecken, wohin denn hätten wir fliehen sollen? Wir hatten keine wirkliche Vorstellung von der Außenwelt. Wir konnten uns keine andere Form des Lebens vorstellen. Träumte ich als Kind von einer wirklichen Mutter, ich konnte sie mir nur in der Welt des Parks denken. Auch schien uns die Außenwelt ein einziger Abgrund, in dem Seuchen wüten, Krankheit und Tod das Leben der Menschen bestimmen. Mit solchen Bildern waren wir aufgewachsen. Nein, an Flucht dachten wir nicht. Wir planten nichts, überließen uns vielmehr dem, was kommen sollte. Nie hat mich Paul in den Park zurückgetragen. Stets kehrte ich allein zurück, oft genug lange nach Einbruch der Dunkelheit. Licht, das da und dort aus den Fenstern verstreut liegender Pavillons fiel, wies mir den Weg. Zwar kannte Paul den Park, die Pavillons und all die anderen Gebäude, hatte er doch immer wieder Wege mit neuem Kies zu bestreuen, den Rasen zu mähen, Hecken zu schneiden oder morsche Bäume umzusägen. Freilich war ihm dabei nie eine der Frauen, eines der Mädchen untergekommen, waren doch solche Arbeiten stets dann zu erledigen, wenn sich alle in der Großen Kammer versammelt hatten, was sich über Stunden ziehen konnte. Nie hätte er es gewagt, außerhalb dieser Zeitfenster die nahezu unsichtbare Trennlinie zu überschreiten.
Fühle ich mich verfolgt? Solche Gedanken sind mir nicht fremd. Manchmal sind sie ohne Bedeutung, dann wiederum kann ich mich ihnen nicht entziehen. Ich stelle, gehe ich schlafen, keine Gläser vor meine Wohnungstüre, deren Geklirre mich aus dem Schlaf reißen würde, versuchte jemand, in die Wohnung einzudringen. Mein Misstrauen gilt mehr jenen, die ich in die Wohnung einlade. Manchmal lege ich Papierstöße so, dass es mir auffallen müsste, sollte sich einer daran zu schaffen machen. Wächst mein Misstrauen, so kann ich an Schubladen Fäden befestigen, die reißen, zieht sie jemand heraus. Aber warum sollte sich das Unternehmen für mich interessieren? Und dann verfolgen mich doch solche Ängste. Was wöge mein Leben, würde über den Park berichtet, drohte ein Kurssturz? Um mein Leben fürchte ich im Augenblick nicht. Das Unternehmen hätte sich meiner leicht entledigen können. Es hätte genügt, mich nach einer Behandlung nicht mehr aufwachen zu lassen. Man hätte mich in die Fabrik zurückgeschickt, aus der ich hervorgegangen bin. Wie leicht hätte man mich in den Tod hinüber leiten können. Früher einmal hätte man mich im Kloster der Reinigung oder in den Kerkern des Guten Hirten verschwinden lassen. Warum nicht in den Häusern der Buße oder im Hospiz der Verlorenen.[6]
Mein Gefühl sagt mir etwas anderes, es sagt mir, dass der Park heute noch mein Leben organisiert, und dies nicht nur wohlwollend. Das monatlich überwiesene Geld ist vielleicht als Schweigegeld zu verstehen. Oder man bezahlt mich aus ganz anderen Gründen. Vermutlich erbringe ich heute noch eine Leistung. Sicher weiß das Unternehmen mein trauriges Schicksal zu nutzen. Unternehmen, auch so ein seltsames Wort, unternehmen wir denn nicht auch täglich manches, eine Wanderung, einen Einkauf, einen Ausflug zu einem Badesee (eine schreckliche Vorstellung). Mein Gefühl, Gegenstand eines Unternehmens zu sein, hat wesentlich zu meinem Misstrauen gegenüber Menschen beigetragen. Lerne ich in einer Bar einen Mann kennen, dann hege ich oft diesen Verdacht. Zweifellos bilde ich mir das oft genug nur ein. Aber ich erinnere mich an mehrere Gelegenheitsbekanntschaften, die dafür sprechen. So erwähnte einmal einer beiläufig Dinge, die nur jemand wissen kann, der mit meiner Lebensgeschichte vertraut ist. Es berührt mich eigenartig, erwähnt jemand, ohne dass ich davon gesprochen hätte, das Museum mit seinen Ornaten. Kein normaler Mensch kommt auf die Idee, über das Aufwachsen in einer Parklandschaft zu sprechen. Alles andere als eine Zufallsbekanntschaft. Er sprach mich an. Und hätte er mich nicht angesprochen, ich wäre auf ihn gar nicht aufmerksam geworden, er wäre Teil einer gesichtslosen Masse geblieben. Mit der üblichen Masche. Es berühre ihn immer seltsam, wenn er in einem Lokal jemanden schreiben sehe, so ganz in Gedanken versunken. Ob ich Schriftstellerin sei und was für eine schöne Schrift ich hätte. Sagt das jemand, der selbst keine Zeile schreibt, dann ist Vorsicht geboten. Obwohl ich es wissen hätte müssen, ließ ich mich auf eine Unterhaltung ein. Dabei finde ich Typen seiner Art, denen man das Fitnessstudio ansieht, nicht besonders anziehend. Eine unnatürliche Bräune, die sich nicht harter Arbeit unter brütender Sonne verdankt. Ohne mich lange zu fragen, setzte er sich an meinen Tisch, neben mich. Ich weiß nicht mehr auf welches Stichwort hin, aber plötzlich kam er auf Rinderweiden zu sprechen. Dabei sah er so gar nicht nach Landwirtschaft aus. Manche trieben es gerne auf Rinderweiden.
„Warum sollte es solche Menschen nicht geben?“, meinte ich. Es gäbe doch die seltsamsten sexuellen Obsessionen. An welche Ausschweifungen er denn denke? Nach längerem Hin und Her, einigen erfundenen Geständnissen meinerseits, beschrieb er ein für mich bemerkenswertes Tableau. Es kostete mich Mühe, meine Aufregung nicht zu zeigen. Er stellte sich einen großen Raum vor, ein Theater mit Bühne und Zuschauerraum, eine Theatermaschine, die eine auf einem Behandlungsstuhl ruhende Frau (Geschlecht entblößt, die Beine abgewinkelt und auf Halterungen aufliegend) aus der Tiefe auftauchen lässt. Seltsam gekleidete Diener sollten bereitstehen, um ihm dieses oder jenes zu reichen. „Einen Essigschwamm?“, fragte ich.
„Ein Schwamm ja, aber doch kein Essigschwamm. Einen Schwamm, um das Geschlecht zu reinigen. Einen Rasierpinsel, die nötige Seife, ein Rasiermesser, ein weißes Becken mit warmem Wasser, Tücher und dergleichen.“
„Sie denken an Doktorspiele. Ist das nicht kindisch?“
„Sie vergessen das Publikum, all die Zuschauer.“
„Diese sitzen doch im Dunkeln. Auch stünden Sie mit dem Rücken zu ihnen, nicht anders als katholische Priester früher einmal während der Wandlung vor dem Altar standen.“
„Aber ich vernähme das leiseste Räuspern, hörte das Publikum atmen, spürte, wie sich dessen Aufregung zur Erregung steigert.“
„Der Begattungsakt wäre wohl als Höhepunkt der Aufführung zu betrachten. Dann ein ernüchternder, wenn nicht peinlicher Abgang. Einer der bereitstehenden Diener würde Ihnen wohl ein Tuch reichen, damit Sie sich das Geschlecht abwischen können, um es in der Hose wieder zum Verschwinden zu bringen. Die Frau auf dem Behandlungsstuhl lässt mich an eine Scheintote denken. Nicht die geringste Regung geht von ihr aus. Soll sie vor ihrem Erscheinen, von einem Auftreten kann ja keine Rede sein, in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden?“
„Auf keinen Fall! Sie müsste sich mir, einem völlig Unbekannten, aus freien Stücken anbieten, über sich verfügen lassen, ohne eine einzige Willensäußerung zu zeigen.“
„Nicht die Frau böte sich an, andere wären es, die sie feilböten. Zweifellos würde es sich um eine Ausgelieferte handeln.“
„Denken Sie nicht, dass es Frauen gibt, die auf solche Art genommen werden wollen?“
„Wie ein Pfirsich oder ein Stück Fleisch? Mir sind solche Vorstellungen fremd.“
„Dabei habe ich jetzt die ganze Zeit an Sie gedacht, stellte mir vor, Sie lägen auf dem Behandlungsstuhl und böten Ihr Geschlecht dar.“
Das war mir nun doch zu widerlich.
„Sie hätten Zurüster werden sollen“, meinte ich, rief die Kellnerin, bezahlte, kramte meinen Sachen zusammen und verließ wortlos das Lokal.
Es war keine Zufallsbekanntschaft. Vom Park hatte er allerdings keine Ahnung, sonst hätte er mich nicht so blöd angeschaut, als ich Zurüster erwähnte. Er wusste auch nichts Genaueres über das Fest der zusammenprallenden Steine, wenn die Phantasie auch keinesfalls auf seinem Mist gewachsen ist. Zweifellos hatte er sie einem Dossier zu meiner Person entnommen. Wie zielstrebig er doch auf mich zukam! Er dachte wohl, ich hätte solche Phantasien. Der Park in seiner ganzen Wirklichkeit sollte also nur ein Produkt meines Gehirns sein. Wäre er sich dessen nicht so sicher gewesen, keinesfalls hätte er sich so plump verhalten. Leider weiß man andere nicht immer richtig einzuschätzen. Meine Einsamkeit machte mich anfällig für solcherlei Enttäuschungen. Und jede dieser Enttäuschungen steigerte mein Misstrauen. Das Fremdsein war für mich stets so etwas wie eine Hoffnung. Nur Fremde können sich gegenseitig erkunden, entdecken. Fühlt man sich im Fremdsein aufgehoben, dann ist es schrecklich, muss man plötzlich erkennen, vom anderen mit Aktenaugen betrachtet zu werden.
Deborahs Tod, ich habe ganz vergessen, ihn zu erwähnen, hatte mich anfällig für solche Begegnungen gemacht. Mit ihr verlor ich nicht nur den einzigen Menschen, dem ich vertrauen konnte, der mich verstand, dem ich alles erzählen konnte, ich musste auch das Gartenhäuschen aufgeben und wieder in meine Wohnung zurückkehren. Eines Abends, als sie nach ihrer Arbeit nach Hause fuhr, womöglich war sie übermüdet, vielleicht auch nur einen Augenblick lang unaufmerksam, in Gedanken versunken oder durch die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos geblendet, wir wissen es nicht, kam sie von der Straße ab und wurde aus dem sich überschlagenden Wagen geschleudert, an einer an sich, wie man meinen möchte, ganz ungefährlichen Stelle. Von wie vielen Zufällen doch das Leben eines Menschen abhängen kann! Ich war dort. Die Straße scheint überzugehen in ein flaches Maisfeld. Zwischen der Straße und dem Maisfeld verläuft ein schmaler Entwässerungsgraben, den man aus einem vorbeifahrenden Auto gar nicht wahrnimmt, zumal während des Sommers, wenn er mit Springkraut überwuchert ist. Sooft ich mit Deborah diese Strecke fuhr, nie war mir dieser Graben aufgefallen, schon gar nicht die kleine Betonsäule, die eine Elektrizitätsgesellschaft errichtet hat, um den Verlauf eines Starkstromkabels deutlich zu machen. Wäre der Wagen nicht gegen diese Betonsäule geprallt, er sich nicht überschlagen. Deborah wäre ausgestiegen und hätte einen Pannendienst angerufen. Aber da ragte eine kleine Betonsäule aus dem Erdreich, die einem Erwachsenen gerade einmal bis zu den Knien reicht. Ihr Freund rief mich an. Im ersten Augenblick war es mir, als stürze die Welt über mir zusammen.
Natürlich wusste ich, dass jeder Mensch stirbt, sei es in jungen Jahren oder in hohem Alter. Aber dieses Wissen war nur abstrakt in mir verankert. Es schien mit mir so wenig zu tun zu haben wie Schlupfwespen, die ihren Legestachel zur Eiablage in eine Schmetterlingsraupe bohren. Bekanntlich fressen die Larven ihren Wirtsorganismus von innen heraus auf, wobei sie lebenswichtige Organe der Raupe schonen, gilt es doch, den Wirt bis zur Verpuppung am Leben zu erhalten. Auch wenn wir solches wissen, es berührt uns nicht. Es ist nur gewusst, nicht erlebt oder erfahren. Mochte ich auch um die Endlichkeit des Lebens wissen, so konnte ich es mir doch nicht vorstellen. Die Welt, in der ich aufwuchs, kannte keinen Tod, nicht einmal Krankheit, sieht man von leichten Erkrankungen ab, wie einer Erkältung. Aber an einer Erkältung stirbt man nicht. Nach wenigen Tagen ist sie überstanden. Ich verstehe erst heute, warum immer wieder eine der Geweihten verschwand. Gestorben wurde an anderen Orten. Sie wurden nicht versetzt, man hat ihnen keine Aufgabe an einem anderen Ort zugewiesen. Sie unternahmen keine Urlaubsreise. Sie verschwanden einfach, verschwanden, weil der Park keinen Tod kennen durfte, nur Leben, neues Leben. Erst in dem Augenblick, in dem Deborahs Freund mich anrief, wusste ich, dass der Tod jeden treffen kann und nicht nur in Büchern vorkommt. Das hat mich nicht weniger erschüttert als der Verlust eines Menschen, der mir ganz nahe stand.
Deborah wurde auf dem Friedhof eines kleinen Dorfes beerdigt. In diesem Dorf war sie zur Welt gekommen, aufgewachsen. Ihre Eltern lebten noch. Ich hatte nie zuvor in meinem Leben an einem Begräbnis teilgenommen, wusste nicht einmal, wie man sich dabei zu verhalten hat. Ich kam zu spät. Ich war erstaunt, als ich einen Priester vor dem offenen Grab stehen und Gebete sprechen sah, hatte mir Deborah doch gesagt, sie glaube an keinen Gott. Das beschäftigte mich in diesem Augenblick nicht sehr, wurde mir doch schmerzlich bewusst, dass ich nicht zu den Trauergästen zählte, die dicht gedrängt um das offene Grab standen und sich alle zu kennen schienen. Allein schon durch meine Kleidung, ich trug weiße Stiefel, einen kurzen weißen Rock und, da es leicht regnete, einen kurzen weißen Mantel, fiel ich aus dem Rahmen. Alle anderen waren dunkel gekleidet. Längere Zeit beobachtete ich das Geschehen aus der Ferne, wagte erst allmählich näher zu treten, allerdings ohne mich unter die Trauergäste zu mischen. Eine kleine Blaskapelle spielte Trauermärsche, nein, es waren keine schweren Trauermärsche. Ihre Musik klang zwar traurig, kannte aber auch einen heiteren Ton, ganz so, wie es Deborah gefallen hätte. Erst als die Trauergäste den Friedhof verließen, ging ich zu dem offenen Grab. Ich sah zwei Totengräbern zu, die Erde auf den mit Blumen bedeckten Sarg warfen. Die beiden schenkten mir keine Beachtung. Bis sie ihre Arbeit erledigt, mehrere Kränze auf den Erdhügel gelegt hatten, ihre Werkzeuge nahmen und den Friedhof verließen. Ich blieb allein zurück. Nun konnte ich meinen Tränen freien Lauf lassen.
Anmerkungen
Handschriftliche Randnotizen, eingelegte Notizblätter sowie Anmerkungen des Herausgebers. Letztere sind in eckige Klammern gesetzt.
Handschriftliche Randnotizen, eingelegte Notizblätter sowie Anmerkungen des Herausgebers. Letztere sind in eckige Klammern gesetzt.