Kapitel 14
Einer der Ausflüge, die wir unternahmen, führte Neurath und mich in eine aufgelassene Kartause. Vom Kreuzgang aus, der um einen quadratisch angelegten Innenhof führt, konnte man kleine Häuschen betreten, in denen jeweils ein Mönch gelebt hatte. All diese Häuschen waren einzig mit einem Gebetsstuhl, einem Tisch, einem Sessel, einem Ofen und einer Werkbank ausgestattet, wobei der Raum durch einen quergestellten Bettkasten in zwei kleinere Räume zerfiel, von denen der eine dem Gebet und der Betrachtung, der andere der Arbeit gedient hatte. Vor dem Häuschen ein kleiner, von einer hohen Mauer eingefasster Garten. Neben der Eingangstür eine Durchreiche für das in der Küche zubereitete Essen. Die Mönche hatten nur an Sonntagen gemeinsam gegessen, ansonsten, abgesehen von den täglichen Gebetszeiten, den ganzen Tag allein verbracht. Der erwähnte Bettkasten erschien mir eine sehr sinnreiche Konstruktion, lassen sich doch darin alle Unordnungen der Nacht, darunter böse Träume, zum Verschwinden bringen. Neurath interessierte sich nicht sehr für das Leben der Mönche, schon gar nicht für die Inneneinrichtung ihrer Behausungen. Er setzte sich im vorgelagerten Garten in die Sonne und rauchte. Eine gute Gelegenheit, mich in einen solchen Bettkasten zu legen. Offensichtlich waren die Mönche kleiner als ich gewesen. Da ich auf dem Rücken lag, musste ich meine Beine anwinkeln und an der Kastenwand abstützen. Kaum hatte ich die beiden Türflügel geschlossen, mich entspannt, schien es mir, als hätte ich alles Äußere abgestreift. Nur durch kleine Ritzen und einige Astlöcher fiel Licht in den Kasten. Es roch nach Zirbenholz. Roch es wirklich nach Zirbenholz? Eher nach Körperausdünstungen von längst verstorbenen Schläfern. Ich dachte an das Leben der Mönche. Es fiele mir schwer, den Tag kurz vor Mitternacht zu beginnen, und das mit einer zumeist mehrstündigen Andacht in einer wohl oft kalten Kirche. Große Mühe hätte ich mit einem Tagesablauf, der alles bis in das kleinste Detail regelt. Gab es glückliche Mönche? Was geschah mit jenen, die unter ihrem Leben litten, die aufbegehrten, die begannen, an Gott zu zweifeln?
Ich musste an Paul denken. Gefangenschaft war eines der Themen, die ihn beschäftigten. Er dachte dabei weniger an dunkle Verließe oder Kerker, in denen Gefangene an Wände gekettet sind. Er fragte sich: „Können Gefangene glücklich sein?“ Er interessierte sich für Gefangene, die ihre Gefangenschaft nicht mehr als solche erleben, die im Besitz des Schlüssels sind, diesen aber nicht benutzen, um ihrer Gefangenschaft zu entkommen, sondern um sich selbst einzusperren. Jahre später sollte ich dies in einer psychiatrischen Anstalt selbst beobachten. Nach dem Frühstück versammelten sich die Kranken vor der Tür, die ins Freie führte. Wurde diese Tür geöffnet, setzte sich eine merkwürdige Prozession in Bewegung. Verrückte, auf diese oder jene Art wahnsinnig geworden, Krüppel oder von Geburt an Verwachsene hinkten, stolperten oder liefen raschen Schrittes auf einem geteerten Streifen einem Gehege zu. Es bedurfte keines Aufsehers. Einer der Kranken trug den Schlüssel bei sich. Der Schlüsselwart, in dieser Welt oberster Würdenträger. Er sperrte das Tor des Geheges, nichts anderes als eine mit einem hohen Maschendrahtzaun umgebene, große baumlose Kiesfläche mit einfachen Toiletten und einigen Überdachungen, die Schutz vor der Sonne oder dem Regen boten, auf. Hatte der letzte der Kranken das Tor passiert, versperrte der oberste Würdenträger das Tor von innen. Keiner der Kranken kam auf die Idee davonzulaufen. Mehr noch, alle hätten sich gerne an der Stelle des Schlüsselwarts gesehen.
Paul hatte recht: „Das perfekte Gefängnis kennt keine Aufseher.“ Einmal schenkte er mir ein Blatt, das er aus einem alten Kalender herausgerissen hatte: „Patent zur Beförderung von Schwerverbrechern ohne Aufsichtspersonal“, und zwar von der Zelle zur Fabrik, wo sie zur Arbeit angehalten würden, in die Kirche, auch in den Hinrichtungsraum: „An den Decken der Gänge sind Schienen montiert. An diesen Schienen, die ein leichtes, nahezu unmerkliches Gefälle aufweisen, hängen an gut geölten Rollen Säcke zum Transport der Gefangenen. Postsäcke, die sich von außen mit Hilfe eines Reißverschlusses verschließen lassen. Nur der Kopf des eng verschnürten Gefangenen ragt aus dem Sack. Zieht der Aufseher an einem dünnen, an der Rolle befestigten Seil, so löst sich dank eines einfachen Mechanismus die Fixierung und der Gefangene bewegt sich fort, ohne sich selbst zu bewegen, ohne sich selbst bewegen zu können. Schwere Zellentüren, Fenster, lange, quer verlaufende Korridore ziehen an ihm vorbei wie aus einem fahrenden Zug betrachtete Landschaften. Der Aufseher hat es nicht verabsäumt, das Frachtstück mit dem entsprechenden Farbcode zu versehen, was es anderen leicht ermöglicht, dort, wo Wege sich gabeln, die Weichen richtig zu stellen (Fabrik, Kirche, Hinrichtungsraum).“
„Und wie gelangen die Gefangenen wieder in ihre Zellen, sofern ihre Hinrichtung dies nicht überflüssig macht?“
„Das Gefängnis ist spiralförmig angelegt, was in all den Gängen eine leichte, fast unmerkliche Steigung erlaubt. Jeder der Räume, ganz gleichgültig, ob es sich um Zellen, Fabrikationshallen, die Küche oder die Desinfektionskammer handelt, ist entsprechend eingefügt. An all den Endpunkten – auffallenderweise ist selbst jener Raum, der der Übernahme von Neuankömmlingen dient, als Endpunkt gedacht – befinden sich schmale Wendeltreppen in ein höher gelegenes Stockwerk. Soll ein Gefangener in seine Zelle gelangen, so muss er, es bleibt ihm keine andere Wahl, die Treppe hochsteigen. Oben angekommen, hat er auf einem Podest mit seinen Schuhen in den vorgesehenen Sack schlüpfen. Ein Aufseher zieht den Reißverschluss hoch und betätigt einen Hebel, wodurch der Gefangene den Boden unter seinen Füßen verliert und sich das Frachtgut nicht allzu schnell, aber doch mit absoluter Sicherheit der jeweiligen Zelle zubewegt.“[1]
Paul fand dieses Patent nicht sehr überzeugend: „Ein zum Tod Verurteilter müsste aus eigenem Antrieb die Hinrichtungszelle aufsuchen, Scham empfinden, käme er zu spät zu seiner Hinrichtung, und sei es nur deshalb, weil er sich in den vielen Korridoren und Stockwerken verirrt, das Leitsystem nicht richtig verstanden hat. Auch ein Henker verdient Respekt. Man darf ihn nicht warten lassen.“ Neurath riss mich aus diesen Gedanken. Ich hörte seine Schritte. Er öffnete die beiden Kastentüren, sah mich wortlos an. Er gab sich gelangweilt, ging im Raum umher, ohne etwas anzuschauen. Tatsächlich war er ungeduldig, wohl auch wütend, weil ich mich im Kasten verkrochen hatte, nicht mit ihm sprach. Bei jedem Vorbeigehen ließ er eine der beiden Türen zuschlagen, wobei die Tür jedes Mal, so als hätte sie eine Feder eingebaut, wieder aufsprang.
„Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Siehst du nicht, dass ich nachdenke. Lass mich in Ruhe ...“
„Lass mich in Ruhe. Glaubst du, es gefällt mir, so trostlose Räume anzuschauen?“
„Was würde dir denn gefallen?“
„Es gefiele mir, würdest du dich ausziehen, es gefiele mir, deinen Rock hochzustreifen, es gefiele mir ...“
„Wir befinden uns in einem Museum. Jederzeit könnte jemand eintreten.“
„Vergiss all die Arschlöcher.“
„Hast du dir nie die Frage gestellt, ob es glückliche Gefangene geben kann?“
„Die Mönche, die hier gelebt haben, haben sich für ihr Unglück entschieden.“
„Bist du glücklich? Glücklich habe ich dich noch nie erlebt. Vielleicht waren sie glücklicher, zufriedener, als wir es sind. Gefällt dir etwas nicht, dann denkst du an etwas, was unterhaltsamer, aufregender sein könnte. Ich stell mir dich in einem Raum vor, in dem zahllose Bildschirme an der Wand hängen. Und ich sehe dich, aus gutem Grund gelangweilt, zwischen all den Bildschirmen zappen.“
„Aber sie waren Gefangene, ihre eigenen Gefangenen. Sie haben sich ihr Gefängnis selbst geschaffen. Und hätte man sie nicht vertrieben, so lebten immer noch Mönche hier, nicht viel anders als im Mittelalter.“
„Freiheit hat eine Entscheidung zur Voraussetzung. Hast du dich wirklich jemals für etwas entschieden, dein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen? Das meint etwas anderes als zwischen Angeboten zu wählen.“
Genau in diesem Augenblick betrat ein älteres Ehepaar den Raum. Ich stieg aus dem Kasten und meinte nur:
„Man soll den Henker nicht warten lassen. Auch ein Henker verdient Respekt.“
„Am vollkommensten gehorchen jene, die nicht nur ihren Willen, sondern auch ihren Verstand und ihr Urteil dem Henker unterwerfen. Dieser Gehorsam schließt alle Fragen nach dem warum, weshalb, wozu aus. Mag auch das Aufgetragene unzweckmäßig, ungerecht, selbst grausam erscheinen, so müssen sie überzeugt sein, dass ihr Gehorsam für sie das Vollkommenste ist.“
Eines Abends lag ich mit Paul auf einer der Rinderweiden. Wir betrachteten den aufgehenden Mond. Es war der Mond, nicht der Lichtschein des Stromboli, der mir aus einem Buch in Erinnerung war. Die Sichel zeichnete sich scharf ab. Wir sprachen über Zurüster, Badediener, auch über den Bischof von Aleppo. Plötzlich meinte er:
„Von Kind an warst du gezeichnet. Ich auch. Wir tragen keine Brandmale, zumindest keine, die allen sichtbar wären. Dann wiederum doch. Was immer ich mache, auch was du machst, ES ist IHM bekannt. Nur wenn ich mit dir zusammen bin, bin ich DU. Sonst laufe ich als ES herum, als ein ETWAS, das sich den Erwartungen entsprechend verhält oder auch nicht. IHM ist auch bekannt, dass wir uns in diesem Augenblick auf dieser Wiese herumtreiben. Manchmal träume ich davon, wir wären als Gerüche zur Welt gekommen, ohne klare Begrenzung. Kennst du die Geschichte vom König, der sich nichts sehnlicher als ein Kind wünschte?“
„Woher soll ich diese Geschichte kennen?“
„Ich will sie dir erzählen. Da wünschte sich ein König einen Sohn, aber die Königin wollte und wollte nicht schwanger werden.“
„Warum hat er nicht die Dienste von Zurüstern in Anspruch genommen? Sie hätten der Königin zwei hochwertige Embryonen eingepflanzt.“
„Das war damals noch nicht möglich, gab es doch nicht einmal Autos. Wollte man jemandem, der an einem anderen Ort lebte, etwas mitteilen, so konnte man nicht einfach zum Telefon greifen. Man musste sich selbst auf den Weg machen. Ein König konnte es sich leisten, einen Boten zu schicken. Selbst elektrischer Strom war unbekannt. In der Küche brannte deshalb stets ein Feuer im Herd. Wie auch immer, der König ließ die besten Ärzte kommen, aber die Königin wurde nicht schwanger. Das verbitterte ihn so sehr, dass er sich in seinem Schloss einsperrte und auf jeden schoss, der sich ihm näherte. Dabei fluchte er auf folgende Art: ‚Riegel, öffne dich, du bist mein Schicksal. Man schlachte einen weißen Ochsen für den Riegel, ein Rind für das Schloss, einen makellosen Widder für den Türpfosten. Rippenfett.’ So vergingen Jahre. Eines Tages kam ein kleiner alter Mann vorbei und wollte eingelassen werden. Es muss wohl der Bischof von Aleppo gewesen sein, trug er doch ein Kinderkostüm, Kriegsmarine, auf dem Kopf eine Bischofsmütze, die gar nicht zum Kostüm passen wollte. Auch auf ihn schoss der König, der an jenem Tag besonders wütend war. Aber dem Bischof von Aleppo konnten die Gewehrkugeln nichts anhaben. Nach seinem seltsamen Verhalten gefragt, rief ihm der König zu, dass er sich vergeblich einen Sohn gewünscht habe und seine Dynastie mit ihm ende. Deshalb habe er sich zurückgezogen und den Riegel vorgeschoben.“
„Wie könnte die Königin, ist das Schloss verriegelt, schwanger werden? In dieser Geschichte scheint mir die Königin das abgeriegelte Schloss zu sein. Will man nicht, dass ein Fuhrwerk zu einem Parkplatz vordringt, der bereits belegt ist, dann versperre man ihm den Weg.“[2] „So dachte man erst lange später. Denk an das Feuer im Herd, an brodelnde Suppentöpfe.“
„Was antwortete der Bischof von Aleppo?“
„Wenn es weiter nichts sei, so könne der König ganz beruhigt sein. Er solle schlafen gehen. Die Königin werde bald schwanger, wenn nicht, so lasse er sich die Ohren abschneiden. Der König solle das Herz eines Drachens beschaffen und es von einem noch unberührten Mädchen zubereiten lassen. dann solle die Königin davon essen.“
„Das muss vor langer Zeit gewesen sein.“
„Vor sehr langer Zeit. Wie auch immer, es gelang den Jägern des Königs, einen Drachen zu töten. Dem Rat des Bischofs von Aleppo folgend, suchte der König in seinem Schloss nach einem unberührten Mädchen.“
„Das lässt mich an das Fest der zusammenprallenden Steine denken.“
„Es gab keine Feier, auch war das Mädchen ganz nebensächlich. Der König schickte es nur mit dem Drachenherz in die Küche. Aber dann geschah etwas, was sich niemand vorstellen konnte. Kaum hatte das Mädchen das Herz mit einer Sellerieknolle, Karotten, Zwiebeln, Petersilie und anderen Kräutern über das Feuer gestellt, wurde es durch den aufsteigenden Dampf schwanger. Dasselbe geschah der Königin, als ihr die Suppe in einer goldenen Schüssel aufgetragen wurde. Exakt im selben Augenblick brachten die beiden, das Mädchen und die Königin, zwei Jungen zur Welt, die einen Drachen zum Vater hatten, die sich Gerüchen, dem Dampf einer Suppe verdankten.“
„Oben und unten scheinen vertauscht. Die Nase als Organ der Empfängnis? Das ist nicht möglich.“
„Was macht das schon, wird eine Königin schwanger?“
„Wir sind auch Drachenkinder.“
„Ja, aber haben wir je unsere Väter gesehen? Zweifellos haben auch sie viele Köpfe, die auf langen Hälsen sitzen, in diese, dann in jene Richtung blicken, Halstänze aufführen. Mehr als zwölf. Unsere Drachenväter kennen keine Gestalt, nicht einmal einen Ort. Sie sind überall.“
In meine frühere Welt kann ich nicht mehr zurück. Das verbieten allein die vielen Fragen, die ich stellen würde. Verstünde mich eine der Geweihten? Wohl nicht. In der Welt, in der ich jetzt lebe, bin ich nicht wirklich angekommen. Sie ist mir fremd. In bin durch ein Zeitloch gefallen. Ich lebe in einer falschen Zeit. Lebte ich nur einige Jahrzehnte später, ich hätte wenig Mühe, verwandten Irrläufern zu begegnen. Oft genug hoffte ich einer der Frauen aus dem Park zu begegnen. Keine einzige lief mir über den Weg. Aber was heißt das schon? Ich erinnere mich gut an meine Zeit als Geweihte. Immer wieder verschwand die eine oder andere. Kehrten sie als Mütter in den Park zurück? Wechselten sie in die Außenwelt? Ließ man sie verschwinden? Ich weiß es nicht. Mag man Geweihten eine gute Ausbildung zubilligen, so stehen sie doch Kühen näher als den Menschen. Wie Kühe werden sie produziert. Genaugenommen befinden sie sich im Eigentum des Parks. Wir wussten um die Funktion der Austragemütter. Auf sie blickten wir mit großer Verachtung herab. Dabei bin ich keiner dieser Frauen je persönlich begegnet. Heute weiß ich, dass sie, zumeist aus gesellschaftlichen Randgruppen rekrutiert, Rechte haben, Rechte im eigentlichen Sinn, mögen diese noch so bescheiden und wohl oft nur schwer durchsetzbar sein. Immerhin stehen sie in einem Beschäftigungsverhältnis und ein solches setzt eine gegenseitige Übereinkunft voraus. Unlängst las ich einen der Verträge, den Frauen unterzeichnen müssen, die als Austragemutter arbeiten wollen. Die Bezahlung erfolge monatlich in Form eines Grundgehaltes, dann in Form von Prämien, die nach erbrachter Leistung bzw. nach dem im Vertrag festgelegten Punktesystem abgegolten würden. Prämien gälten für: Zeitdisziplin, Befolgung der notwendigen medizinischen und psychologischen Untersuchungen vor einem Embryonentransfer, für alle mit dem Embryonentransfer verbundenen Eingriffe, alle Untersuchungen während und nach der Schwangerschaft, psychologische Betreuungstermine, die konfliktfreie Trennung von dem oder den ausgetragenen Kind(ern) und für die Einhaltung der während der Schwangerschaft vorgeschriebenen Regeln, wie dem Verbot von Nikotin, Alkohol und Suchtgiften, sexueller Abstinenz, der Vermeidung schwerer körperlicher Tätigkeiten oder Leistungssport, nicht zuletzt auch für die Einhaltung gewisser Ernährungsregeln. Die Bezahlung entspreche gesetzlich festgelegten Tarifen. Dies gelte auch für Abschläge, die bei einem missglückten Embryonentransfer zur Geltung kämen. Was immer man über diese Art der Beschäftigung denken mag, so haben wir es doch mit einer Übereinkunft zu tun, mit Wahlmöglichkeiten, mögen auch die meisten der Frauen kaum Alternativen zu dieser Arbeit haben. Jede Frau, die sich bewirbt, könnte sich gegen eine Vertragsunterzeichnung entscheiden. Ich hatte diese Möglichkeit nie. Ich wurde wie andere Mädchen ausgewählt, und zwar in einem Alter, in dem ich noch lange keine empfängnisfähige Frau war. Als Geweihte ist man rechtlos. Geweihte werden produziert, nicht angeworben. Mag man atmen, Wünsche und Gedanken entwickeln, und doch ist man Teil einer Maschinerie, wird selbst zu einer Maschine, auch als solche gedacht. Eine Geweihte kann keine Dienstleistung erbringen. Da gibt es nichts Drittes, das man vor sich herschieben könnte wie einen Kinderwagen, einen Einkaufswagen. Die Geweihten sind es, die geschoben werden, mögen sie auch glauben, sich selbst zu bewegen. Ich bin aber keine Maschine.[3] Zweifellos unterliegen auch die Geweihten einem Punktesystem (‚credits‘), hing doch ständig, wenn auch unausgesprochen, die Drohung im Raum, ins Bodenlose zu fallen, sollte man den Erwartungen nicht entsprechen.
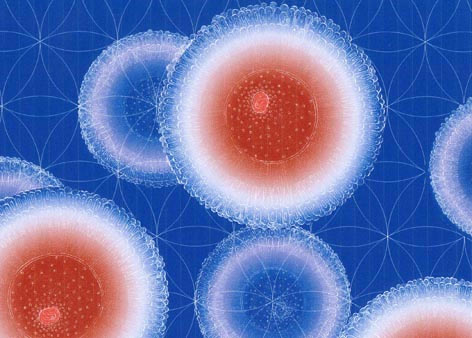 |
Manchmal dachte ich daran, mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, nicht anders als adoptierte Kinder, die nach ihren leiblichen Eltern suchen, oder Kinder, deren Existenz sich einer Samen- oder Eizellspende verdankt, nicht viel anders als Organempfänger, die beschäftigt, in welchem Körper das Herz schlug, dem sie ihr zweites Leben verdanken. In ähnlicher Weise phantasierte ich meine leiblichen Eltern, und das im Wissen, sie nie zu finden. Meine Eltern sind sich nie begegnet. Ich verdanke mein Leben weniger meinen genetischen Eltern als einem Konzern, der Ei- und Samenzellen in der Absicht ausgewählt hat, eine von vielen hochwertigen Eizellproduzentinnen herzustellen. Meine Elternsuche kann nur in die Irre führen. An wen sollte ich mich wenden? An den Aufsichtsrat? An den Vorstand des Unternehmens? An den ärztlichen Leiter? An einen der Aktionäre? Eine seltsame Vorstellung, einen der vielen Aktionäre als Teilvater zu betrachten. Dieser Aktionär hätte sein Geld ebenso gut in der Pharmaindustrie oder einem Rüstungsbetrieb anlegen können. Elternschaft kennt Bindung, Verantwortung, Geld weder das eine noch das andere. Meine Eltern, ein Konglomerat aus räumlichen, symbolischen oder ökonomischen Zufällen. Im Gegensatz zu allen Behauptungen bin ich ein wahres Zufallsprodukt, mochte man mich auch genauestens geplant haben.
Ich fühlte mich im Park nie eingesperrt, schon gar nicht empfand ich ihn als Gefängnis, bestenfalls bedrückte mich eine gewisse Beengtheit, eine Empfindung, die an Bedeutung gewann, als ich Paul kennenlernte. Obwohl ich wusste, dass mir solche Begegnungen verboten waren, ein Verbot übrigens, das nie wirklich ausgesprochen worden, aber fest in uns verankert war, ja selbst diesbezügliche Gefühle keinen Platz haben durften, trieb es mich immer wieder auf die Rinderweiden, um Paul zu begegnen. Oft sprachen wir über den Park, über das, was unseren Träumereien entgegenstand. Paul konnte in lebhaften Farben eine gemeinsame Reise an den Oberlauf des Orinoco ausmalen. Er beschrieb mir den Urwald, seine Geräusche, erzählte von Menschen, die in kleinen Gruppen im Urwald lebten, nicht anders als vor tausenden von Jahren. Er erzählte mir von einem Indio, der sich in ein Jaguarweibchen verliebte und was dann geschah. Wir verloren uns in solchen Träumereien, wohl wissend, dass jedes unserer Treffen das letzte sein konnte. Nicht ich, Paul war es, der die Welt, in der wir lebten, als bedrückend empfand.
Eines Abends, ich kann mich gut erinnern, regnete es doch heftig, weshalb wir Schutz in einem der Unterstände suchten, sprach er von einem Spiel:
„Gespielt wird die Flucht eines Gefangenen aus einem Festungsgefängnis. Auf einer Tischplatte ist eine weiträumige Anlage mit Zellen, Korridoren, inneren und äußeren Höfen, Mauern und Toren zu sehen. Will der Gefangene in die Freiheit gelangen, dann muss er die ganze Anlage durchqueren. Ob ihm seine Flucht gelingt oder nicht, hängt von einem einzigen Schritt ab, den er während seiner Flucht zu machen hat. Ein einziges Zaudern und schon ist er verloren.“
„Kann man sich entscheiden, ob man Fuchs oder Henne spielt?“
„Nein. Das würde keinen Sinn machen. Der Gefangene, er ist tatsächlich ein Gefangener, kann nicht den Aufseher des Gefängnisses spielen. Nie wird er an dessen Stelle treten.“
„So verdoppelt sich im Spiel die Grausamkeit des Alltags.“
„Manche Fluchtwege sind von vornherein als Sackgassen angelegt. Die vielen kleinen Türchen lassen sich durch Tastendruck auf- und zuklappen, und weiß der Aufseher geschickt zu spielen, dann legen sich alle Fangarme des Labyrinths um die rollende Kugel.“
„Der Gefangene kann nur verlieren! Ein Spiel sollte doch beiden dieselben Chancen einräumen. Sonst ist es kein Spiel. Wer immer mit einem König spielt im Wissen, dass es seinen Kopf kosten wird, ganz gleich ob er gewinnt oder verliert, der spielt nicht.“
„Kinder lernen gehen, sehen, spielen und denken, nur das Wichtigste lernen sie nie, nämlich richtig wollen. So verkümmert ihr Instinkt für schnelle Entscheidungen.“[4]
„Sie sollten lernen, sich zu fürchten ...“
„... in böser Absicht bezeichnet zu werden.“
„Ich las, jedes Zeichen sei wie ein Gesicht, das sich nur über ein anderes Zeichen öffne.“
„Das Zeichen gibt es erst, wenn es gesehen wird. Sonst ist es bedeutungslos, tot.“
„Ich wurde durch einen Code bezeichnet. Ich selbst bin das Zeichen. Durch welches andere Zeichen ließe es sich öffnen?“
Ich versuchte, dieses Spiel aus Pappkarton nachzubauen. Es gab mehrere Versionen. Damals lebte ich im Garten. Mein Tun stürzte meine Umgebung in eine große Unruhe. Niemand tadelte mich, aber alle begannen mich zu meiden, selbst Rita, der ich mich sehr nahe fühlte. Sie legte sich abends nicht mehr auf mein Bett, schmiegte sich nicht mehr an mich, um mir von ihren kleinen Sorgen zu berichten oder eines ihrer Geheimnisse zu beichten. Auch ich zog mich zurück. Wie hätte ich Rita, inzwischen zählte sie unter den Geweihten zu den besten, von den Rinderweiden, von Paul erzählen können?
Abends traf ich ihn auf den Rinderweiden. Wir sprachen darüber. Das Spiel beschäftigte uns. Es war mehr als ein Spiel, das jedes Kind, jeder Erwachsene zu spielen weiß, wurde es doch zunehmend bevölkert, nein, nicht von Menschen, sondern von all den Bauwerken des Parks, da der Garten mit dem weißen Gebäude, dort all die Pavillons, das REGISTER, die Große Kammer, nicht zu vergessen das Schlösschen, in dem die Große Mutter residiert, das Schlösschen, dem wir uns als Kinder noch weniger zu nähern wagten als dem Garten. Der Ausgang des Spiels war klar. Ich wusste nur nicht, wie die rote Kugel ins Spiel kommen würde, wusste aber, dass ich reagieren würde müssen. Eines abends, als ich von einem meiner langen Spaziergänge zurückkehrte, war das Spiel verschwunden. In diesem Augenblick wurde ich mir bewusst, dass ich nicht länger im Park leben konnte, dass ich Paul nie mehr sehen würde. Ich fiel in die kalte Außenluft. An das Licht musste ich mich erst gewöhnen. Freiheit fand ich auch hier nicht. Auch hier scheinen Schatten mit der Wirklichkeit verwechselt zu werden. Sieben schmale Fächer für die Rasiermesser, andere Fächer mit Schreibwerkzeug, das Fach mit der Seifenschale sei nicht vergessen. Scheidemünzen. Ihr Metallwert liegt weit unter dem aufgeprägten Wert. An eine Flucht ist nicht zu denken. Es gibt keine Öffnung, die zum Licht hinauf führt. Das große Wagnis, es macht keinen Sinn. Es gilt und gibt nichts zu wagen.
Wieder einmal ein ziemlich trauriger Tag. Ich fühlte mich niedergeschlagen, war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Es war mir, als seien unter meinem Schädeldach Krokodile aus ihren Eihäuten geschlüpft und würden sich regen. Es war mir, als säße ich in einer Glaskugel, in der Sätze geschüttelt werden, die dann wie Schneeflocken herunterfallen, langsam in mein Gedächtnis, wo sie liegen bleiben, ohne Sinn und Ordnung. Am liebsten hätte ich mich verkrochen, eine Schneedecke über mich gelegt, wäre gerne einschlafen, um nie wieder aufzuwachen. Eine wunderbare Ruhe, liegen und erstarren unter Tannenästen, im Schnee.[5] Mit geschlossenen Augen daliegen, Schneeflocken spüren, die auf mein Gesicht, auf Stirn und Lider, Lippen und Nase fallen. Schneefall, der jeden Lärm erstickt.
Solche Stimmungen sind nicht einfach als eine Verwirrung des Gehirns zu betrachten, oder als Angst, verrückt zu werden, es sind Schmerzen, die mit dem ganzen Körper empfunden werden, es ist ein Schmerzzustand. Ich kenne nur eine Linderung. Ich muss mich bewegen, mich anstrengen, bis zur Erschöpfung. Oft genug bin ich ins Katzenloch geflüchtet, wobei ich mir stets vornahm, bis zur Schneealpe zu gehen, mich dort auszuheulen, und zwar an jener Stelle, an der ich Deborah das letzte Mal begegnet war. An jenem Tag sind wir uns sehr nahe gekommen, in einer Mulde zwischen blühenden Almrosen. Von dort sieht man das ganze Land unter sich, Dörfer und Städte, Industrieanlagen, auch den Park, alles so klein wie eine Spielzeuglandschaft, so dass es scheint, als könne man nach Belieben eingreifen, mit einem einzigen Handgriff dieses oder jenes Gebäude entfernen und an eine andere Stelle setzen, das REGISTER etwa, das von oben ganz deutlich zu erkennen ist, wie die Große Kammer oder der Komplex.
Ich ließ mich von einem Taxi an jene Stelle bringen, von der unsere gemeinsamen Wanderungen durch das Katzenloch stets ihren Ausgang genommen hatten. Der Herbst machte sich bemerkbar. Die Lärchen warfen ihre Nadeln ab. Obwohl es warm war, trocknete der Reif an schattigen Stellen erst gegen Nachmittag ab. Die Landschaft, sich selbst überlassen. Kein Mensch. Keine Vogelstimme. Eine eigenartige Ruhe. Manchmal ein Falter, der sich in der Jahreszeit geirrt hatte. Morgen, so dachte ich mir, wird er erfroren, Gott näher gekommen sein. Was für eine eigenartige Vorstellung. Vielleicht ist es nur das Alleinsein, die Abwesenheit von Menschen, nicht das Gefühl von Erhabenheit, das uns an Gott denken lässt, an seine Einsamkeit, an ihn, der keine schmierigen Tentakel oder gallertigen Fäden kennt, die sich zurückziehen ins Universum, wenn sie sich vollgesogen haben.[6]
An einer von vielen Kaskaden, die hier errichtet wurden, um drohenden Sturzbächen ihre Kraft zu nehmen, musste ich an den jungen Mann denken, einen Theologiestudenten, der sich hier das Leben nahm. Deborah hat mir von ihm erzählt, auch die Stelle gezeigt. Damals habe es tagelang heftig geschneit, der dicht fallende Schnee habe jede Spur verwischt, weshalb man vergeblich nach dem Vermissten gesucht habe. Erst als die Sonne wieder durchbrach, sei der Tote, nackt und in sitzender Stellung, mit dem Rücken an die Mauer gelehnt, am Fuße einer der Kaskaden zufällig von einem Tourengeher entdeckt worden. Es habe klirrende Kälte geherrscht, weshalb der Bach nur wenig Wasser geführt habe. Das Gesicht des Toten wie nahezu sein ganzer Körper sei von Eis überzogen gewesen, nur sein rechter Arm habe im herabstürzenden Wasser einmal auf diese, dann auf jene Seite geschlagen, so als lebte er noch. Dass sich der Theologiestudent nicht einfach betrank und in den Schnee legte, um zu erfrieren, das nötigt mir Respekt ab. Nein, so als ginge er zu Bett, womöglich dachte er an eine Badewanne, an Reinigung, so kleidete er sich aus, stapfte durch den Schnee die Böschung hinunter, stieg über eine Eisfläche in das eiskalte Wasser, watete, mit seinen Beinen Halt zwischen Steinen suchend, hin zur Kaskade, deren massiver Sockel ihm wohl als Sitzbank erschienen sein mochte, setzte sich, lehnte sich seitlich an einen Mauervorsprung, legte seinen linken Arm auf einen behauenen Stein, der aus der Mauer ragte. In dieser Stellung, er muss sich ganz konzentriert haben, blieb er sitzen. So sehr mich das Ende des Theologiestudenten berührt und ich mir heute noch, komme ich im Katzenloch an diesem Wasserfall vorbei, sein von Eis überzogenes Gesicht vorstelle, seinen rechten Arm, der im herabstürzenden Wasser einmal auf diese, dann auf jene Seite schlägt, als lebte er noch, eine solche Todesart würde ich nie wählen. Um mein Leben zu beenden, wäre es angemessener, in flüssigem Stickstoff ein Bad zu nehmen. Flüssigem Stickstoff verdankt es sich, in flüssigem Stickstoff sollte es enden. Das ist nur leichtfertig hingesagt, weiß ich doch von keiner mit flüssigem Stickstoff gefüllter Badewanne, in die ich mich legen, in die ich eintauchen könnte. Das Bild scheint mir aber treffend, wie sich im Bild des von Eis überzogenen Theologiestudenten seine ganze Geschichte verdichtet, er sie selbst zum Ausdruck gebracht hat, sie zu lesen wäre, verstünde man es nur. Das gilt wohl für jeden Selbstmord, dies selbst dann, gerät durch irgendwelche Unwägbarkeiten, und solche gibt es viele, das Bild durcheinander. Der Theologiestudent hätte nach vorne kippen können. Dann wäre er mit dem Gesicht nach unten im Wasser zu liegen gekommen und es hätte sich ein anderes Bild ergeben. Aber auch dieses hätte sich betrachten und lesen lassen. Bedauerlicherweise scheint all jenen, die mit solchen Fällen zu tun haben, eine solche Lektüre fremd. Zu sehr verwiese sie auf ihr eigenes Leben, ihre eigene Verletzlichkeit. Die sorgsam abgelegte Kleidung des Theologiestudenten wurde zweifellos wahrgenommen, aber unter all den Merkwürdigkeiten, die mit solchen Geschichten verbunden sind, als nebensächlich abgetan. Die Todesursache wurde festgestellt, Fremdverschulden war auszuschließen. Das ist verständlich, aber noch lange keine Anleitung für eine Bildbetrachtung.
Eines Tages fand ich in meinem Briefkasten einen großen Umschlag, darin mehr als hundert Schwarzweißabzüge, Aufnahmen, die Deborahs Begräbnis zeigten. Jemand muss sie vom Glockenstuhl des Kirchturms aus gemacht haben, war doch auf allen der Friedhof aus demselben Blickwinkel von schräg oben zu sehen. Obwohl die abgebildeten Menschen sehr klein wirkten, was sich nicht nur der Entfernung, sondern auch der Perspektive verdankte, erkannte ich mich beim ersten Durchblättern der Fotos, hob ich mich doch durch meine weißen Stiefel, meinen weißen kurzen Rock und den weißen Mantel deutlich von all den anderen ab. Deborahs Begräbnis. Ich erinnerte mich, an meine Unsicherheit, an das Gefühl, nicht dazuzugehören. Nein, die Fotos schrien es geradezu heraus, ich stand außerhalb, war und bin aus der Zeit gefallen. Ich kam nicht nur zu spät, ich stand erst am Grab, als alle den Friedhof bereits verlassen hatten. Es ist ein großer Unterschied, ob man an einem Geschehen teilnimmt oder dieses, wie es der Fotograf gemacht hatte, aus einer größeren Distanz betrachtet, oder auch ich, die ich nun diese Fotos durch meine Finger gleiten ließ und mich selbst als eine unter vielen sehen konnte. Dass der Friedhof von einer Steinmauer umfasst war, das fiel mir erst jetzt auf, so wie die Kindergräber am Ende des Friedhofs. Dass ein Begräbnis eines Kindes nur wenige Tage zuvor stattgefunden hatte, was Kränze und Spielfiguren auf einem kleinen Erdhügel deutlich machten, hatte ich nicht bemerkt. Hätte ich es gesehen, vielleicht hätte ich mich gefragt, wie groß oder alt ein Mädchen sein müsse, um nicht mehr als Kind zu gelten. Zehn oder zwölf Jahre? Zählt das Erreichen der Geschlechtsreife? Letzteres ließe sich wohl oft nur unbestimmt sagen. Im Park ließe sich das Fest der zusammenprallenden Steine als Stichtag nennen, es war buchstäblich ein Stichtag, aber der Park kennt den Tod nicht, somit auch keinen Friedhof, keine Stelle, an der Kinder beerdigt werden könnten, womöglich nahe einer hohen Mauer, die den kleinen Seelen Schutz böte vor dem kalten Nordwind. Aber da ich das Kindergrab nicht bemerkt hatte, konnten mich solche Fragen nicht beschäftigen, hätten mich selbst dann nicht beschäftigt, wenn ich das Grab bemerkt hätte, da mir damals anderes durch den Kopf ging. Auch ist es ein großer Unterschied, ob man sich durch unübersichtliches Gestrüpp bewegt, und ich empfand es tatsächlich als unübersichtlich, oder ob man eine Katastermappe desselben Geländes vor sich auf einem Tisch liegen hat oder dieses von einer erhöhten Warte aus betrachtet. Ich wusste nicht einmal, wie man sich bei einem Begräbnis zu verhalten hat. Blätterte ich die Aufnahmen wie in einem Daumenkino rasch durch, so konnte ich die Bewegungen der Trauergemeinde im Zeitraffer sehen. Im Bild rechts unten erscheinen vier Männer, sie haben den Sarg geschultert. Voran schreitet ein Ministrant, der ein Kreuz trägt. Auf den Sarg folgt ein Priester, begleitet von zwei Ministranten, dann dicht aufschließend die Trauergemeinde. Der Zug bewegt sich ordentlich und dann doch unordentlich auf das offene Grab in der letzten Reihe ganz links zu. Dort angekommen, stellen die Träger den Sarg neben dem offenen Grab ab, während sich die Trauergäste um das Grab und den Sarg gruppieren. Im Daumenkino betrachtet lässt das an die Traube eines Bienenschwarms denken, nur dass sich die schwarz gekleideten Menschen nicht um eine Königin drängen, die es zu schützen, zu wärmen oder zu kühlen gilt (dabei hätte es Deborah verdient, als Königin betrachtet und behandelt zu werden), sondern um ein offenes Grab und einen abgestellten Sarg. Wie die Bienen eines Schwarmes richten sich die Trauernden zwischen Hindernissen ein, zwischen einzelnen Gräbern. Hat der Priester die Gebete gesprochen, wird der Sarg mit Hilfe von Stricken in das offene Grab hinabgelassen. Erst in diesem Augenblick betrete ich den Friedhof. Ich sehe mich, ganz abseits stehend, zuerst im Hintergrund, dann bewege ich mich auf die Gruppe, auf den Schwarm zu. In die Nähe des Grabes wage ich mich erst in jenem Augenblick, das ist auf den Aufnahmen ganz deutlich zu erkennen, als sich die Trauergemeinde aufzulösen beginnt und einzelne bereits dem Ausgang zustreben. Da ich im Gegensatz zu all den anderen weiß gekleidet war und deshalb herausstach, sah ich im Daumenkino vor allem mich. Die Aufnahmen galten meinen Bewegungen, meinem Zuspätkommen, meiner Unschlüssigkeit, der Art und Weise, wie ich mich zu nähern suchte und trotzdem abseits blieb, selbst als ich neben wenigen anderen vor dem offenen Grab stand und auf den Sarg hinunterblickte, der von Blumen übersät war, mit denen Deborahs Freunde ihren Schmerz und die ganze Trauer erträglich zu machen suchten. Ich musste an den Star denken, der, aus welchen Gründen auch immer, den Anschluss an den Schwarm, der seinem Winterquartier zustrebte, verloren hatte, der allein zurückblieb und sich plötzlich im Schnee, unter Amseln fand. Wer mochte die Aufnahmen gemacht, sie mir in den Briefkasten gesteckt haben?
Anmerkungen
Handschriftliche Randnotizen, eingelegte Notizblätter sowie Anmerkungen des Herausgebers. Letztere sind in eckige Klammern gesetzt.
Handschriftliche Randnotizen, eingelegte Notizblätter sowie Anmerkungen des Herausgebers. Letztere sind in eckige Klammern gesetzt.