Krankenschwestern an vorderster Front
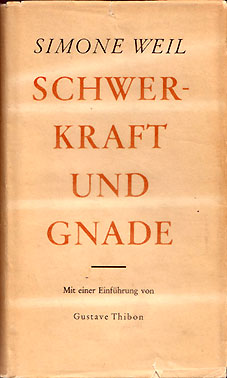 |
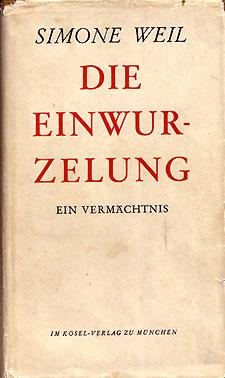 |
Den zerschmetterten Kopf verbinde ich, (arme irre Hand, reiß den Verband nicht weg! Den Hals des Kavalleristen mit dem Durchschuß untersuche ich, Schwer rasselt der Atem, ruhig glänzt schon das Auge, doch das Leben kämpft schwer, (Komm, süßer Tod! lass dich überreden, O schöner Tod! Voller Gnade komm rasch). Walt Whitman, The Wound-Dresser |
Als die Deutschen nach der Besetzung der Tschechoslowakei in Prag eine
Studentenrevolte niederschlugen, arbeitete Simone Weil an einem Plan, mit
Fallschirmen Truppen und Waffen in der Tschechoslowakei abzusetzen. Ihre
pazifistischen Ideale hatte sie zu dieser Zeit längst hinter sich gelassen.
Statt dessen beschäftigte sie sich nun neben vielem anderen mit Fragen der
Kriegsführung. Sie überlegte, wie einem militärisch überlegenen Gegner eine
Invasion schwierig gemacht werden könne. Ihre Vorstellungen einer
dezentralen Organisation des politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Lebens übertrug sie nun auf Fragen der Kriegsführung: "Keine Fronten bilden,
keine Städte belagern, dem Feind nachsetzen, seine Verbindungslinien
blockieren, ihn immer dort angreifen, wo er nicht darauf gefasst ist, ihn
demoralisieren und durch eine Reihe winziger, aber siegreicher Aktionen den
Widerstand anspornen." Ihre diesbezüglichen Überlegungen sollten sich später
mehrfach bestätigen, vorausgesetzt, der dezentral organisierte Widerstand
wurde von einer breiten Bevölkerung getragen. Ihr Plan, mit Fallschirmen den
inhaftierten Studenten zu Hilfe zu kommen, war jedoch sehr persönlich
motiviert. Sollte er verwirklicht werden, so wollte sie unbedingt selbst
daran teilnehmen, mehr noch, sie drohte, sich unter einen Autobus zu werfen,
sollte das Unternehmen ohne sie durchgeführt werden. Ab diesem Zeitpunkt
arbeitete sie an ihrem "Plan zu einer Gruppe von Krankenschwestern an
vorderster Front". Auf den Schlachtfeldern (von der Idee eines
Guerillakrieges war sie mittlerweile abgekommen) sollten junge Frauen
Verwundeten zu Hilfe kommen und Sterbenden in ihrem einsamen Todeskampf
beistehen. Simone Weil nahm in Kauf, dass die meisten dieser Sanitäterinnen
dabei zu Tode kommen, also eine Bluthochzeit feiern würden. Auch an diesem
Unternehmen wollte sie beteiligt, mehr noch, die erste dieser Frauen sein.
Das Abspringen mit dem Fallschirm muss Simone Weil fasziniert haben. Verständlich, denkt man an ihren ungelenken Körper, dem sie alles mit äußerster Disziplin abverlangen, abzwingen musste. Sie war ungeschickt, meist kränkelnd, wurde oft genug von heftigen Schmerzen geplagt: "Ich bin keiner Aufgabe, welche es auch sein möge, gewachsen, und dies gilt für alle Bereiche. Ohne übermäßigen Einsatz aller Kräfte kann ich keine Arbeit durchführen, und dabei habe ich im Herzen die Angst des Schwimmers, der sich fragt, ob er die Kraft aufbringt, das Ufer zu erreichen." Dabei fühlte sie sich im Meer wohl, "wie neugeboren", "reingewaschen von der ganzen angehäuften Ermüdung", im Meer, "welch schönes Taufbecken, falls wir torpediert werden!" Während das Wasser die Schwere des Körpers vergessen macht, kommt beim Absprung mit einem Fallschirm eine gerichtete, selbsttätige Fortbewegung auf ein Ziel hinzu, die Schwerkraft. Trotz ihrer oft schneidenden Nüchternheit dachte sie sich den Fallschirmspringer engelhaft, eben von oben, von Gott kommend. Ihre Biographin Simone Pétrement erwähnt diesbezüglich folgende Erinnerung. Während eines Abendessens (deutsche Truppen hatten Frankreich besetzt) spielte Simone Weil den Fall durch, ein junger deutscher Fallschirmspringer würde auf der Terrasse des Hauses landen, und fragte ihre Eltern, was sie unter diesen Umständen tun würden. "Ihr Vater antwortete mit seinem gesundem Menschenverstand, dass er falls möglich, den Fallschirmspringer der Polizei übergeben würde. Simone erklärte, dass sie nicht weiter mit einem Menschen zu Abend essen könne, der solche Absichten hatte. Ich glaubte zuerst, sie scherze, doch sie schien das in vollem Ernst gesagt zu haben und hörte tatsächlich auf zu essen. Um sie zum Weiteressen zu bewegen, versprach ihr Vater schließlich, dass er, falls es dazu käme, den jungen Fallschirmspringer nicht der Polizei übergeben würde."
Zur Verwirklichung ihres Planes nahm sie Kontakt mit unterschiedlichen Personen auf, so mit dem Schriftsteller JoŽ Bousquet, der im Ersten Weltkrieges von einer Kugel in die Wirbelsäule getroffen worden war, was ihn zum Krüppel machte. Eine Stellungnahme des ehemaligen Offiziers, so hoffte sie, könnte ihrem Plan Gewicht verleihen. Bousquet hielt ihren Plan für durchführbar. Er riet ihr, diesen genauer zu erläutern und in manchen Punkten zu ergänzen. Sie schrieb ihm: "Wenn es, wie ich hoffe, zu einem Resultat führt, so wird dies nicht für mich getan sein, sondern durch mich hindurch für andere, jüngere Brüder von Ihnen, die Ihnen unendlich teuer sein müssen, da sie dem gleichen Schicksal unterworfen sind. Vielleicht werden einige, wenn ihre letzte Stunde gekommen ist, Ihnen die Wohltat eines Blickes verdanken, der ihren Blick erwidert."
Nach London ging Simone Weil in der Hoffnung, von dort aus ihren Plan verwirklichen zu können. Sie wollte mit dem Fallschirm über dem besetzten Frankreich abspringen, um als Partisanin gegen die deutschen Besatzer zu kämpfen. Dafür nahm sie in Kauf, zumindest vorübergehend Dinge tun zu müssen, die ihr nicht überzeugend erschienen, etwa Propagandaberichte für die Presse zu verfassen. Sie absolvierte einen Erste-Hilfe-Kurs, beschäftigte sich mit einem Lehrbuch zur Fliegerei und besorgte sich einen Fallschirmspringerhelm. Sie versuchte, Auto fahren zu lernen. In ihrem Umfeld stieß sie auf Unverständnis. De Gaulle soll ausgerufen haben: "Sie ist ja verrückt." Fortan setzte sie alles daran, in einer gefährlichen Mission nach Frankreich entsandt zu werden. Sie verstand die Gründe nicht, die dagegen sprachen. Bereits während ihres kurzen Engagements im spanischen Bürgerkrieg dachte sie an eine gefährliche Mission hinter den feindlichen Linien. Dabei war sie so ungeschickt, dass andere unruhig wurden, wenn sie auch nur mit einem Gewehr hantierte. Verletzt wurde Simone Weil nicht während einer Kampfhandlung, sondern als sie aus Unachtsamkeit in eine Pfanne mit siedendem Öl trat. Wie damals verstand sie auch jetzt nicht, dass sie, würde sie gefangen genommen, auch andere gefährden würde. Sie war ungeeignet für eine Aktion, die ein abgestimmtes Vorgehen verlangt hätte, nicht nur durch ihre Unberechenbarkeit in vielen Dingen; sie war kurzsichtig, litt oft an furchtbaren Kopfschmerzen und befand sich in einer körperlich schlechten Verfassung.
Simone Weil fand genügend Gründe in der Außenwelt, die ihr Anlass boten sich zu kasteien, den eigenen Körper zu einem "Instrument der Folter und des Todes" für all das zu machen, was sie in ihrer Seele als mittelmäßig betrachtete. In England weigerte sie sich mehr zu essen, als den Franzosen auf den Lebensmittelkarten zugeteilt war. Wirklich zu hungern begann sie in dem Augenblick, als ihr "Opferwunsch" abgelehnt wurde. Es muss für Simone Weil wohl eine großartige Vorstellung gewesen sein, als wirkliches Opfer vom Himmel zu fallen, sich einer absoluten Ohnmacht (für Außenstehende einer tragischen Lächerlichkeit) auszuliefern. Mit einer Thérèse von Lisieux, deren Erfolg sie darin sah, einen "Aufzug" erfunden zu haben, "mit dem man in den Himmel gelangt", wusste sie wenig anzufangen. Nein, sie wollte vom Himmel auf die Erde fallen. Simone Weil bezog sich auf archaische Opfermythen, etwa auf den von Tacitus erwähnten Brauch der Germanen, ein junges Mädchen vor die vorderste Schlachtreihe zu stellen. Der Absprung mit dem Fallschirm als technische jungfräuliche Niederkunft, in der Geburt und Tod in eins fällt, auch eine Art Vermählung, Hochzeit.
Ihren Plan verstand Simone Weil längst als Berufung, dessen Durchführung ihren Tod zur Folge haben würde: "Ich will dienen, ich will dahin gehen, wo die Gefährdung so groß wie nur möglich ist und wo mein Leben am wenigsten geschützt sein wird. [...] Ich habe die feste Gewissheit, dass dies nicht nur eine Frage des Charakters, sondern der Berufung ist ..." Sie reagierte gekränkt, als eine ihrer Kameradinnen für einen Fallschirmeinsatz in Frankreich ausgewählt wurde, und suchte diese zu überreden, ihr den Platz zu überlassen. Statt im Feindesland fand sie sich in Krankenzimmern wieder, umgeben von Krankenschwestern, von "einigen blutjungen, sehr netten Engländerinnen", die so ganz anders waren als die von ihr erdachten "Krankenschwestern an vorderster Front". Simone Weil starb am 24. August 1943 in Ashford. Auf dem Totenschein stand: "Versagen des Herzens ... infolge Unterernährung und Lungentuberkulose. Die Verstorbene ... tötete sich selbst durch ihre Weigerung zu essen, während ihr seelisches Gleichgewicht gestört war."
Bernhard Kathan, 2010
Das Abspringen mit dem Fallschirm muss Simone Weil fasziniert haben. Verständlich, denkt man an ihren ungelenken Körper, dem sie alles mit äußerster Disziplin abverlangen, abzwingen musste. Sie war ungeschickt, meist kränkelnd, wurde oft genug von heftigen Schmerzen geplagt: "Ich bin keiner Aufgabe, welche es auch sein möge, gewachsen, und dies gilt für alle Bereiche. Ohne übermäßigen Einsatz aller Kräfte kann ich keine Arbeit durchführen, und dabei habe ich im Herzen die Angst des Schwimmers, der sich fragt, ob er die Kraft aufbringt, das Ufer zu erreichen." Dabei fühlte sie sich im Meer wohl, "wie neugeboren", "reingewaschen von der ganzen angehäuften Ermüdung", im Meer, "welch schönes Taufbecken, falls wir torpediert werden!" Während das Wasser die Schwere des Körpers vergessen macht, kommt beim Absprung mit einem Fallschirm eine gerichtete, selbsttätige Fortbewegung auf ein Ziel hinzu, die Schwerkraft. Trotz ihrer oft schneidenden Nüchternheit dachte sie sich den Fallschirmspringer engelhaft, eben von oben, von Gott kommend. Ihre Biographin Simone Pétrement erwähnt diesbezüglich folgende Erinnerung. Während eines Abendessens (deutsche Truppen hatten Frankreich besetzt) spielte Simone Weil den Fall durch, ein junger deutscher Fallschirmspringer würde auf der Terrasse des Hauses landen, und fragte ihre Eltern, was sie unter diesen Umständen tun würden. "Ihr Vater antwortete mit seinem gesundem Menschenverstand, dass er falls möglich, den Fallschirmspringer der Polizei übergeben würde. Simone erklärte, dass sie nicht weiter mit einem Menschen zu Abend essen könne, der solche Absichten hatte. Ich glaubte zuerst, sie scherze, doch sie schien das in vollem Ernst gesagt zu haben und hörte tatsächlich auf zu essen. Um sie zum Weiteressen zu bewegen, versprach ihr Vater schließlich, dass er, falls es dazu käme, den jungen Fallschirmspringer nicht der Polizei übergeben würde."
Zur Verwirklichung ihres Planes nahm sie Kontakt mit unterschiedlichen Personen auf, so mit dem Schriftsteller JoŽ Bousquet, der im Ersten Weltkrieges von einer Kugel in die Wirbelsäule getroffen worden war, was ihn zum Krüppel machte. Eine Stellungnahme des ehemaligen Offiziers, so hoffte sie, könnte ihrem Plan Gewicht verleihen. Bousquet hielt ihren Plan für durchführbar. Er riet ihr, diesen genauer zu erläutern und in manchen Punkten zu ergänzen. Sie schrieb ihm: "Wenn es, wie ich hoffe, zu einem Resultat führt, so wird dies nicht für mich getan sein, sondern durch mich hindurch für andere, jüngere Brüder von Ihnen, die Ihnen unendlich teuer sein müssen, da sie dem gleichen Schicksal unterworfen sind. Vielleicht werden einige, wenn ihre letzte Stunde gekommen ist, Ihnen die Wohltat eines Blickes verdanken, der ihren Blick erwidert."
Nach London ging Simone Weil in der Hoffnung, von dort aus ihren Plan verwirklichen zu können. Sie wollte mit dem Fallschirm über dem besetzten Frankreich abspringen, um als Partisanin gegen die deutschen Besatzer zu kämpfen. Dafür nahm sie in Kauf, zumindest vorübergehend Dinge tun zu müssen, die ihr nicht überzeugend erschienen, etwa Propagandaberichte für die Presse zu verfassen. Sie absolvierte einen Erste-Hilfe-Kurs, beschäftigte sich mit einem Lehrbuch zur Fliegerei und besorgte sich einen Fallschirmspringerhelm. Sie versuchte, Auto fahren zu lernen. In ihrem Umfeld stieß sie auf Unverständnis. De Gaulle soll ausgerufen haben: "Sie ist ja verrückt." Fortan setzte sie alles daran, in einer gefährlichen Mission nach Frankreich entsandt zu werden. Sie verstand die Gründe nicht, die dagegen sprachen. Bereits während ihres kurzen Engagements im spanischen Bürgerkrieg dachte sie an eine gefährliche Mission hinter den feindlichen Linien. Dabei war sie so ungeschickt, dass andere unruhig wurden, wenn sie auch nur mit einem Gewehr hantierte. Verletzt wurde Simone Weil nicht während einer Kampfhandlung, sondern als sie aus Unachtsamkeit in eine Pfanne mit siedendem Öl trat. Wie damals verstand sie auch jetzt nicht, dass sie, würde sie gefangen genommen, auch andere gefährden würde. Sie war ungeeignet für eine Aktion, die ein abgestimmtes Vorgehen verlangt hätte, nicht nur durch ihre Unberechenbarkeit in vielen Dingen; sie war kurzsichtig, litt oft an furchtbaren Kopfschmerzen und befand sich in einer körperlich schlechten Verfassung.
Simone Weil fand genügend Gründe in der Außenwelt, die ihr Anlass boten sich zu kasteien, den eigenen Körper zu einem "Instrument der Folter und des Todes" für all das zu machen, was sie in ihrer Seele als mittelmäßig betrachtete. In England weigerte sie sich mehr zu essen, als den Franzosen auf den Lebensmittelkarten zugeteilt war. Wirklich zu hungern begann sie in dem Augenblick, als ihr "Opferwunsch" abgelehnt wurde. Es muss für Simone Weil wohl eine großartige Vorstellung gewesen sein, als wirkliches Opfer vom Himmel zu fallen, sich einer absoluten Ohnmacht (für Außenstehende einer tragischen Lächerlichkeit) auszuliefern. Mit einer Thérèse von Lisieux, deren Erfolg sie darin sah, einen "Aufzug" erfunden zu haben, "mit dem man in den Himmel gelangt", wusste sie wenig anzufangen. Nein, sie wollte vom Himmel auf die Erde fallen. Simone Weil bezog sich auf archaische Opfermythen, etwa auf den von Tacitus erwähnten Brauch der Germanen, ein junges Mädchen vor die vorderste Schlachtreihe zu stellen. Der Absprung mit dem Fallschirm als technische jungfräuliche Niederkunft, in der Geburt und Tod in eins fällt, auch eine Art Vermählung, Hochzeit.
Ihren Plan verstand Simone Weil längst als Berufung, dessen Durchführung ihren Tod zur Folge haben würde: "Ich will dienen, ich will dahin gehen, wo die Gefährdung so groß wie nur möglich ist und wo mein Leben am wenigsten geschützt sein wird. [...] Ich habe die feste Gewissheit, dass dies nicht nur eine Frage des Charakters, sondern der Berufung ist ..." Sie reagierte gekränkt, als eine ihrer Kameradinnen für einen Fallschirmeinsatz in Frankreich ausgewählt wurde, und suchte diese zu überreden, ihr den Platz zu überlassen. Statt im Feindesland fand sie sich in Krankenzimmern wieder, umgeben von Krankenschwestern, von "einigen blutjungen, sehr netten Engländerinnen", die so ganz anders waren als die von ihr erdachten "Krankenschwestern an vorderster Front". Simone Weil starb am 24. August 1943 in Ashford. Auf dem Totenschein stand: "Versagen des Herzens ... infolge Unterernährung und Lungentuberkulose. Die Verstorbene ... tötete sich selbst durch ihre Weigerung zu essen, während ihr seelisches Gleichgewicht gestört war."
Bernhard Kathan, 2010